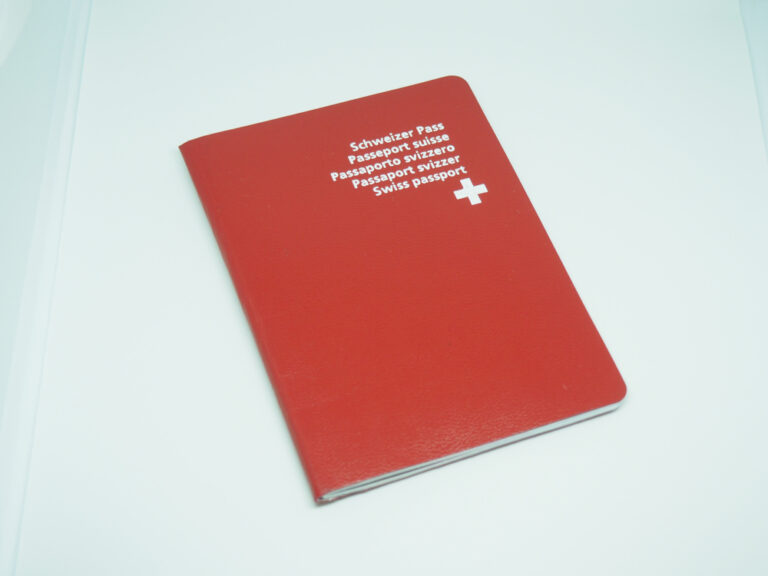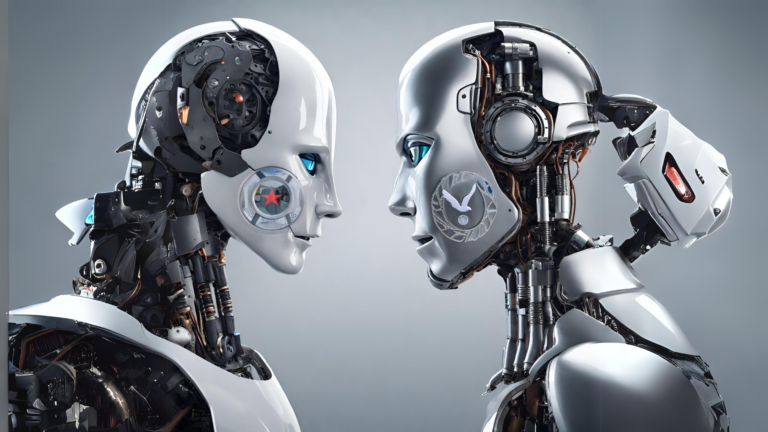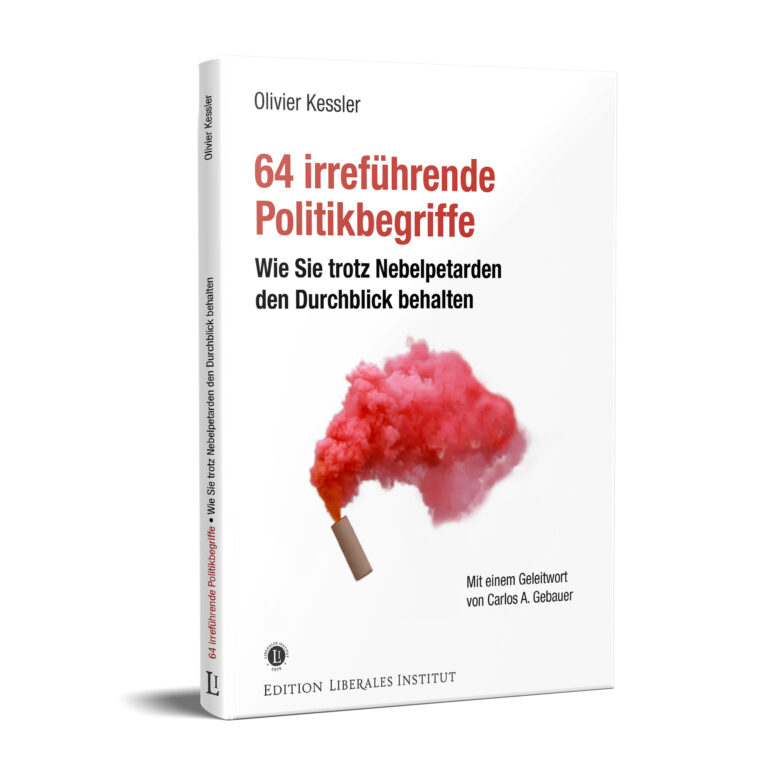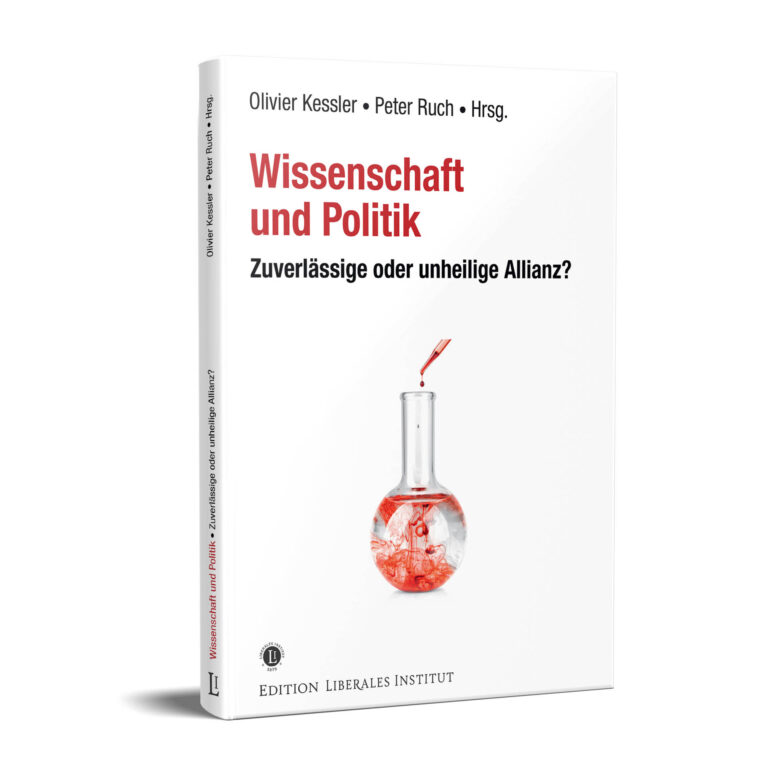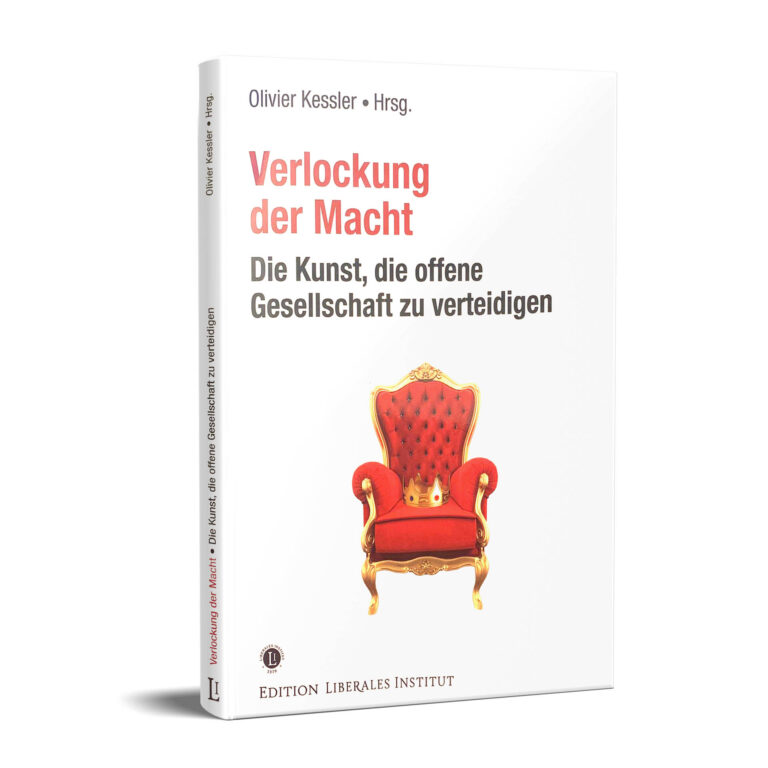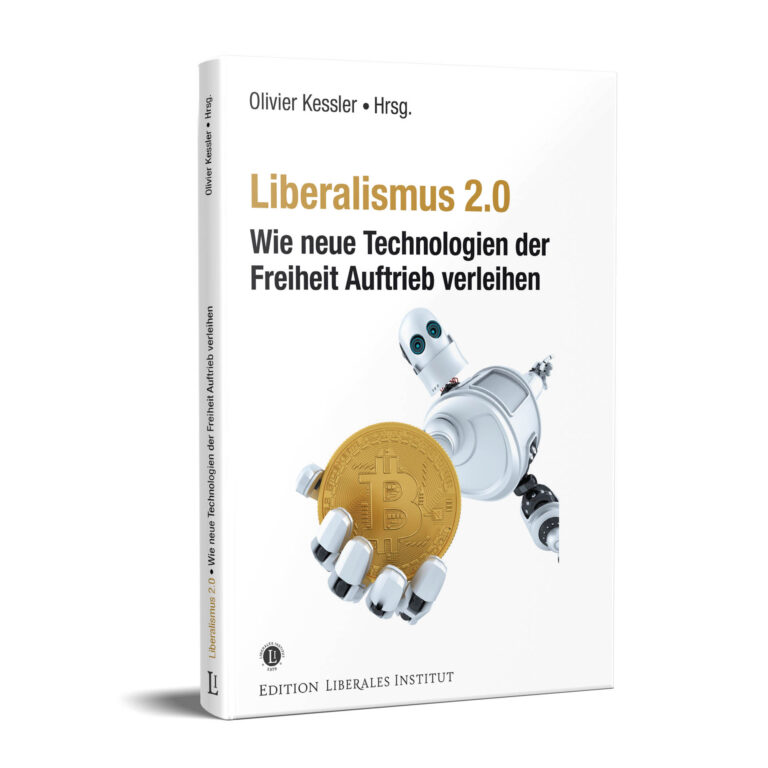Previous slide
Next slide
Denkanstösse
News
Liberty Summer School
Jedes Jahr erhalten 25 Nachwuchstalente während vier Tagen eine spannende Einführung in die Grundlagen von Frieden, Freiheit und Wohlstand.