
In kaum einem Land ist der Begriff der Sozialen Marktwirtschaft so tief verwurzelt wie in Deutschland. Generationen verbinden mit ihm Wohlstand, Aufstiegsmöglichkeiten und soziale Sicherheit. Doch was einmal als Garant für individuelle Freiheit und wirtschaftliche Dynamik galt, droht heute unter einem dichten Geflecht aus Regulierungen, Subventionen und Bürokratie zu ersticken. Die Krise der Sozialen Marktwirtschaft ist nicht allein konjunkturell bedingt – sie ist das Resultat einer schleichenden Abkehr von den ordnungspolitischen Grundprinzipien, die dieses Modell einst stark gemacht haben.
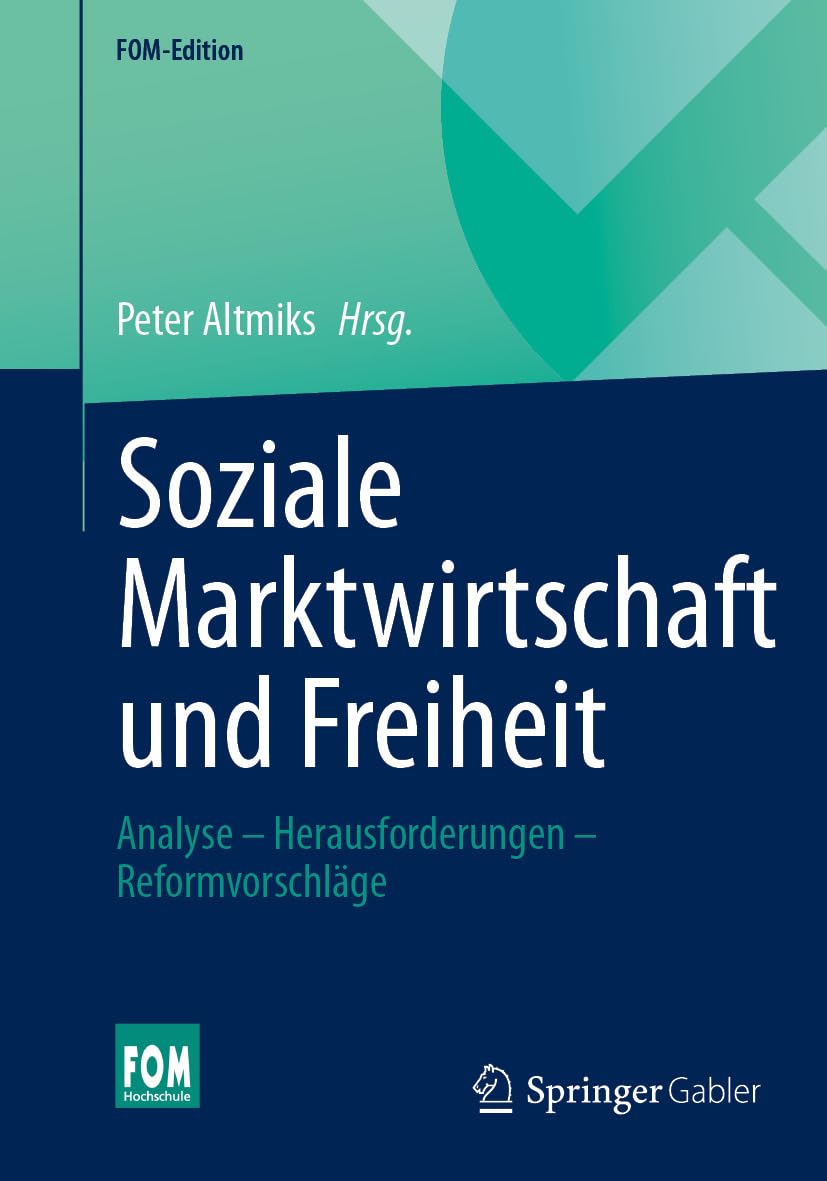
Ein Blick zurück lohnt sich: Nach dem Zweiten Weltkrieg war es alles andere als selbstverständlich, dass Deutschland auf einen marktwirtschaftlichen Kurs einschwenkt. Die Mehrheit der Bevölkerung war planwirtschaftlich geprägt, viele Parteien liebäugelten mit Sozialisierung, Preiskontrollen und einer weitreichenden Staatslenkung. Es war der Mut einzelner Köpfe wie Ludwig Erhard, Wilhelm Röpke oder Walter Eucken, die gegen diese Tendenzen hielten. Sie waren überzeugt: Freiheit ist kein abstraktes Ideal, sondern eine konkrete Voraussetzung für wirtschaftlichen Fortschritt. Ein freier Markt, so ihre Überzeugung, ist das beste Entdeckungsverfahren für Wissen und Innovation. Der Staat hat dabei eine wichtige Rolle – er muss für klare Spielregeln sorgen, Eigentum schützen und Wettbewerb sichern. Doch er darf nicht selbst zum Spielführer werden.
Heute scheint diese Grundhaltung ins Wanken zu geraten. Immer mehr Menschen erwarten, dass der Staat jedes Risiko abfedert, jeden Preis deckelt, jede Krise allein schultern kann. Der Drang zur Intervention hat in den letzten Jahren eine neue Qualität erreicht: Preisbremsen für Energie, Mietendeckel, Subventionen in Milliardenhöhe für einzelne Industriezweige, dirigistische Klimapolitik und eine wachsende Bürokratie, die den Handlungsspielraum von Unternehmen und Bürgern einschränkt. Oft gut gemeint, im Ergebnis jedoch problematisch. Denn jeder staatliche Eingriff erzeugt Nebenwirkungen, die neue Interventionen notwendig machen – ein Teufelskreis aus immer mehr Steuerung und immer weniger Vertrauen in die Kräfte der Eigenverantwortung.
Gerade die Energiepolitik ist ein mahnendes Beispiel. Jahrzehntelang hat man sich auf planwirtschaftliche Instrumente verlassen, um Emissionen zu senken und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Ergebnis: stark steigende Preise, gefährdete Wettbewerbsfähigkeit und eine schwindende industrielle Basis. Statt technologieoffen auf Innovation und marktwirtschaftliche Anreize zu setzen, verheddern wir uns in Subventionen und Verboten.
Ähnliche Muster zeigen sich beim Wohnungsmarkt: Mietendeckel, Enteignungsfantasien oder überbordende Bauvorschriften mindern das Angebot, statt Knappheiten zu beheben. Ein funktionierendes Preissystem wird ausgebremst, Marktmechanismen werden verzerrt – mit spürbaren Folgen für Mieter, Eigentümer und Bauwillige.
Auch die Geldpolitik liefert ein warnendes Beispiel. Die expansive Niedrigzinspolitik der letzten Jahre hat zwar kurzfristig Staaten und Schuldner entlastet, zugleich aber eine Vermögenspreisinflation befeuert, die jene belastet, die nicht über Immobilien oder grosse Aktienpakete verfügen. Der Preis für diese Politik: eine gespaltene Gesellschaft und eine Erosion des Vertrauens in die Stabilität unserer Währung.
Dabei ist die Botschaft ordnungspolitischer Prinzipien so simpel wie kraftvoll: Der Staat muss sich auf das konzentrieren, was er besser kann als jeder Marktakteur – für Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und Haftung zu sorgen. Er muss den Rahmen setzen, nicht die Akteure anleiten. Wenn Haftung privatisiert, Gewinne jedoch sozialisiert werden, wie es in manchen Bankenrettungen oder Subventionsprogrammen der Fall war, untergräbt das das Vertrauen in die Marktwirtschaft. Ebenso, wenn Politiker in immer kürzeren Wahlzyklen mit grosszügigen Versprechen um sich werfen, ohne für solide Haushalte zu sorgen. Die Folge ist eine Staatsquote, die sich der 50-Prozent-Marke nähert – Tendenz steigend. Dabei gilt: Jeder Euro, den der Staat ausgibt, muss zuvor erwirtschaftet werden. Leistungsträger, Mittelstand und Unternehmen tragen diese Last – nicht selten mit wachsender Frustration.
Ordnungspolitik ist dabei alles andere als altmodisch. Sie ist ein modernes Freiheitsversprechen: Sie stellt sicher, dass Menschen planen, investieren und Risiken eingehen können, weil die Spielregeln klar und verlässlich sind. Sie baut auf Eigenverantwortung und Wettbewerb, statt paternalistisch zu bevormunden. Gerade in einer globalisierten Welt, in der andere Wirtschaftsräume auf Deregulierung, Technologiefreiheit und günstige Standortbedingungen setzen, können sich Deutschland und andere europäische Länder keine fortschreitende Selbstblockade leisten.
Was heisst das konkret? Wir brauchen eine konsequente Entlastung der produktiven Kräfte. Bürokratische Hürden müssen abgebaut werden, damit Start-ups entstehen und Mittelständler wachsen können. Steuersysteme müssen einfacher und leistungsfreundlicher werden, damit sich Arbeit lohnt. Subventionen und Förderprogramme gehören auf den Prüfstand: Sind sie wirklich nötig, um Marktversagen zu korrigieren, oder zementieren sie nur bestehende Strukturen? Energie-, Wohnungs- oder Landwirtschaftspolitik müssen so gestaltet werden, dass Märkte Knappheiten anzeigen können – nicht durch Preisdeckelung, sondern durch Innovation und Angebotsausweitung.
Zugleich ist eine Debatte über die Grenzen staatlicher Fürsorge nötig. Ein Sozialstaat, der alles absichert, bremst Eigeninitiative. Ein Sozialstaat, der hingegen aktiviert, Anreize setzt und Chancengleichheit fördert, stärkt die gesellschaftliche Aufstiegsmobilität. Genau darin liegt die eigentliche soziale Komponente der Marktwirtschaft: Sie schafft Wohlstand, der Solidarität möglich macht. Ohne wirtschaftliche Leistungskraft bleibt jedes Versprechen von sozialer Sicherheit hohl.
Nicht zuletzt sollten wir uns daran erinnern, dass auch Europa nicht stärker wird, wenn es nationale Anstrengungen durch zentrale Schuldenvergemeinschaftung ersetzt. Ein funktionierender Binnenmarkt, stabile Währungen und faire Wettbewerbsregeln sind der Schlüssel für europäischen Wohlstand – nicht immer neue Transfers, die nur Symptome kaschieren, aber Ursachen ignorieren.
Die Herausforderung ist gross: Wie kehren wir zurück zu einer Kultur des Vertrauens in Eigenverantwortung? Wie stärken wir eine Debatte, die Mut macht, statt Angst zu schüren? Die Antworten liegen nicht im Ausbau staatlicher Kontrolle, sondern in der Rückbesinnung auf ordnungspolitische Prinzipien, die sich bewährt haben: Freiheit, Verantwortung, Wettbewerb. Die Soziale Marktwirtschaft ist kein Relikt der Vergangenheit, sondern die beste Antwort auf die Fragen unserer Zeit – wenn wir uns wieder trauen, sie mit Leben zu füllen.
Tags:
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.