
Viele Ökonomen haben in den letzten Wochen vor potenziell sehr hohen Preisinflationsraten gewarnt, mit der Begründung, dass eine Geldexpansion von ungeahntem Umfang auf einen negativen Angebotsschock treffe. Andere befürchten hingegen, dass die monetären und fiskalischen Stimuli nicht stark genug sein werden, um den Rückgang der privaten Ausgaben zu kompensieren. Dadurch könnte eine Deflationsspirale in Gang gesetzt werden. In den meisten Fällen irren sich zum Glück beide Seiten.
Betrachtet man die Verbraucherpreisinflationsraten in der Eurozone, dann hat die eher aktionsfreudige Geldpolitik der letzten Jahrzehnte wenig Wirkung gezeigt: Die Geldmenge M1 ist der Eurozone im Zeitraum von 1999-2020 mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 7,59% gewachsen. Damit hat sie sich weit mehr als vervierfacht, während die Verbraucherpreise nur um etwas mehr als 40% gestiegen sind. Subtrahiert man sowohl die durchschnittliche reale Wachstumsrate, als auch die durchschnittliche Verbraucherpreisinflationsrate von der durchschnittlichen Wachstumsrate der Geldmenge M1; dann verbleibt eine Erklärungslücke von etwa 4,6 Prozentpunkten pro Jahr. Wohin fliesst das Geld, wenn es nicht durch höhere Stückpreise für Konsumgüter oder eine grössere reale Produktion absorbiert wird?
Der Inflationsdruck entlädt sich ausserhalb der Konsumgütermärkte, vor allem auf den Märkten für langfristige Vermögenswerte wie Aktien und Immobilien. Die offizielle Inflationsmessung unterschätzt die allgemeine Preisinflationsrate, was für den durchschnittlichen Haushalt nicht unbedeutend ist: Wenn die Vermögenspreise steigen, wird es schwieriger, ein bestimmtes Niveau an Realvermögen zu erreichen. Die Preisinflation findet für die meisten Menschen zwar ausserhalb der offiziellen Zahlen aber dennoch deutlich spürbar statt.
Download LI-Paper
(5 Seiten, PDF)
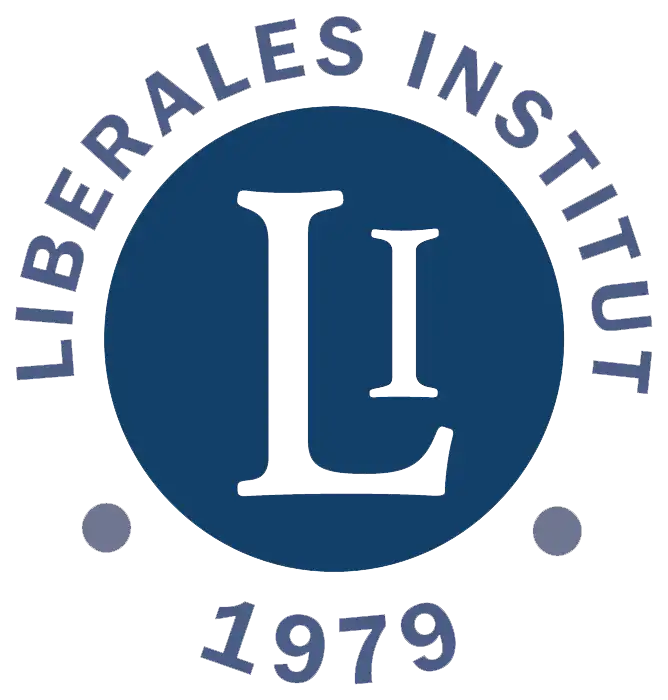
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.