
Die Wettbewerbskommission stellt sich gerne, unter Applaus weiter Teile der Medien, als Hüterin des Wettbewerbs dar. Die Rufe nach einer «Verstärkung» der Kommission, einer «Aufstockung der Mittel» oder einem «griffigeren» Gesetz sind gang und gäbe. Auf den ersten Blick scheint kaum eine ordnungspolitische Aufgabe wichtiger für das Funktionieren einer Marktwirtschaft. Doch die zunehmende Kriminalisierung einzelner wirtschaftlicher Tätigkeiten, die durch Hausdurchsuchungen, hohe Bussen «mit präventivem Charakter» und Denunziationsprämien gekennzeichnet ist, wirft die Frage auf, wie fundiert die staatliche Kontrolle des Wettbewerbs tatsächlich ist.
Die jüngste Kontroverse um die Parole des Weko-Präsidenten für einen EU-Beitritt hat wieder einmal gezeigt, dass hinter der Wettbewerbspolitik oft mehr Politik als Wettbewerb steckt. Ein EU-Beitritt würde u.a. einen Mindestmehrwertsteuersatz von 15%, höhere Zinsen und einen jährlichen Beitrag von 4,9 Milliarden Franken zulasten der Schweizer Steuerzahler bedeuten. Schwer vorstellbar, wie dies den Konsumenten zugute käme, zumal die EU und die Schweiz seit bald 40 Jahren über ein Freihandelsabkommen verfügen. Hinzu kommt, dass viele Produkte in der Schweiz aufgrund der höheren EU-Zölle gegenüber dem Rest der Welt mit einem Beitritt verteuert würden. Werden noch die nötigen institutionellen Umwälzungen im Falle eines Beitritts berücksichtigt, muss diese Debatte aus wettbewerbspolitischer Sicht als geradezu fahrlässig bezeichnet werden.
Es drängt sich der Verdacht auf, dass wir es auch in der Wettbewerbspolitik mit einer behördlichen Anmassung zu tun haben (deren Folgen eine beträchtliche Einnahmequelle für den Staat bedeuten). Wie kann etwa eine Kommission anhand einer «Untersuchung» zu jedem Zeitpunkt abschliessend beurteilen, was der «richtige» Wettbewerb auf einem bestimmten Markt in den unterschiedlichsten Branchen ist? Wenn der Staat, der weder Preissignale noch Gewinnmassstäbe kennt, den richtigen Wettbewerb allwissend verordnen könnte, wäre wohl die Planwirtschaft keine so hoffnungslos untaugliche Wirtschaftsordnung.
In der Praxis impliziert Wettbewerb lediglich Handlungsfreiheit. Er findet dynamisch statt, indem ein Akteur eine Idee umsetzt, die die Konsumenten überzeugt und die Prüfung durch den Markt besteht. Die Wettbewerbspolitik hingegen beruht auf einer statischen Vorstellung des wirtschaftlichen Geschehens. Sie kann die unendliche Vielfalt und den steten Wandel der Präferenzen und der möglichen, auch künftigen Produktionsstrukturen nie umfassend berücksichtigen.
In einer offenen Weltwirtschaft stösst die Wettbewerbspolitik ohnehin schnell auf willkürliche Hürden. Die Wettbewerbsbehörde muss einen Markt stets so eng definieren, dass sie einen Eingriff in ihn rechtfertigen kann. Wenn aber beispielsweise ein Markt durch eine Fusion plötzlich von einem einzelnen Anbieter beherrscht wird, die Konsumenten aber weiterhin Ausweichmöglichkeiten auf andere Substitutionsprodukte haben, besteht das behördlich verfolgte Problem aus Konsumentensicht gar nicht. Erhöht der Produzent seine Preise, werden entweder die Konsumenten auf andere Produkte ausweichen, oder aber neue Produzenten werden von den so entstandenen Gewinnmöglichkeiten angezogen und beleben das Geschäft.
Die Wettbewerbspolitik geht also von einem Modell des Wettbewerbs aus, das so nirgends existiert, nämlich einem Wettbewerb zwischen zahlreichen Firmen, die alle das gleiche auf die gleiche Weise produzieren. In Wahrheit bedeutet Wettbewerb genau das Gegenteil: Er setzt eine Differenzierung voraus! Jeder Anbieter versucht, besser, billiger oder irgendwie anders zu sein, um im Markt zu bestehen. Solange Marktzutritt und Innovation nicht gesetzlich verboten oder erschwert werden, wie es im Falle staatlicher Monopole und Anbieter leider der Fall ist, kann also die Qualität des Wettbewerbs auf einem Markt nie abschliessend beurteilt werden.
Preisabsprachen, die in der Öffentlichkeit einen besonders schlechten Ruf haben, bleiben vor diesem Hintergrund in der Realität oft wirkungslos. Kartelle werden grundsätzlich von innen bedroht, indem jeder Produzent durch erhöhte Preise einen Anreiz erhält, seinen Marktanteil zu maximieren. Dies gelingt aber nur, indem Preise reduziert werden. Vor allem aber werden neue Anbieter durch höhere Preise angezogen. Problematisch sind daher solche Kartelle vor allem dann, wenn bestehende Anbieter durch staatliche Privilegien, wie etwa Regulierungen, Zölle oder administrierte Preise, geschützt und die Eintrittshürden so künstlich erhöht werden.
Wird Wettbewerb also korrekt als dynamisches, unternehmerisches Entdeckungsverfahren verstanden, so kann Wettbewerbspolitik nur eine Ausweitung der Wirtschaftsfreiheit zum Ziel haben — nie eine Kontrolle und Überwachung der Wirtschaft. Unsere zunehmend interventionistische Wettbewerbspolitik beeinträchtigt dagegen inzwischen zunehmend auch solche Lösungen, die für Konsumenten vorteilhaft wirken.
Es ist also Vorsicht geboten: Nicht alles was nach «Wettbewerb» tönt fördert auch den Wettbewerb. Die Wettbewerbspolitik schützt aufgrund ihrer statischen Perspektive immer wieder einzelne Wettbewerber statt des Wettbewerbs an sich. Die Wahlfreiheit der Konsumenten hängt zum Glück nicht von einer zwölfköpfigen Behörde ab, die sich gelegentlich in Bundesbern trifft. Es ist die unendliche Vielfalt und Dynamik freier Konsumenten- und Investitionsentscheidungen, die dem Markt seinen segensreichen Ordnungsrahmen gibt.
Versionen dieses Artikels sind in der «Weltwoche» und der «Zürcher Wirtschaft» erschienen.
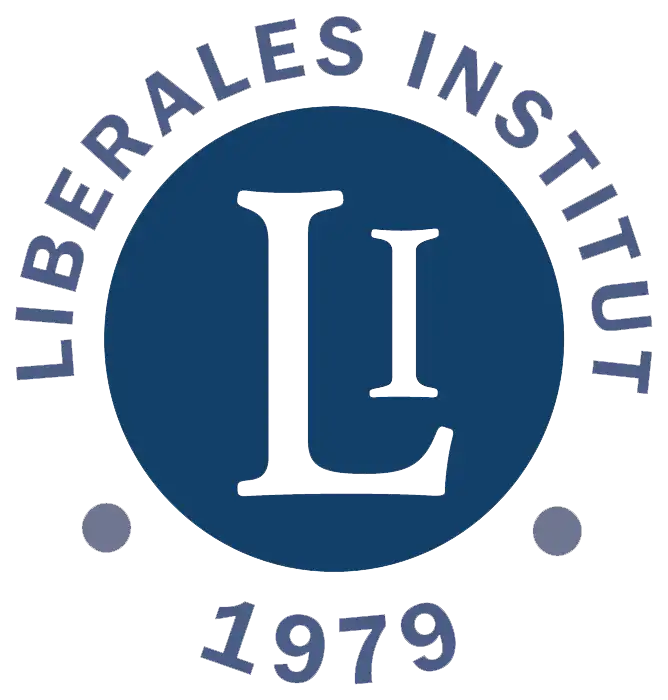
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.