
Wer die real existierende EU analysiert, entdeckt schnell einmal den hohen Stellenwert jener Institutionen, die das Vertragsrecht anwenden und verbindlich auslegen: die Kommission (Exekutive) und der EU-Gerichtshof. Obwohl sie eigentlich dazu nicht berufen sind, nehmen sie in hohem Masse gesetzgeberische Funktionen wahr. Grundlegende allgemeinverbindliche Regeln wie etwa das Cassis-de-Dijon-Prinzip, das den Handel im Binnenmarkt liberalisiert, wurden von Richtern erlassen. Sie gelten allerdings nur auf Abruf, «solange keine gemeinsame Regulierung getroffen ist» und sind darum als provisorisches Verfassungsrecht zwar erfahrungsgemäss relativ dauerhaft, aber weder rechtsstaatlich noch demokratisch fundiert. Wir haben es hier mit einer politisch wertenden Justiz zu tun. Der deutsche Ökonom Roland Vaubel hat in verschiedenen Beiträgen empirisch nachgewiesen, dass oberste Verfassungsgerichte weltweit keine verlässlichen Wächter über die in der Verfassung garantierten Freiheiten sind. Auch in der EU ist die richterliche Gewalt nicht jenes Bollwerk, das für die Individualrechte und gegen die Zentralbürokratie errichtet wurde, sondern der kooperative Partner der Kommission, der die Macht der Exekutiven stützt und legitimiert.
Dasselbe gilt für das Verhältnis von Zentralmacht und Mitgliedstaat, unabhängig davon, ob man es mit einem Staatenbund, einem Staatenverbund oder mit einem Bundesstaat zu tun hat. Die wirksamsten und schonungslosesten Abbauer gliedstaatlicher Eigenständigkeit sind die Verfassungsgerichte gewesen. Was sich im Staatenverbund EU abspielt, ist im Bundesstaat USA im Lauf der letzten 80 Jahre vorexerziert worden: Eine schrittweise Verstärkung der Zentralregierung mit Hilfe höchstrichterlicher Entscheidungen und ohne Einbezug der eigentlich zuständigen Legislativen aller Stufen, kurz: Politik durch Richterrecht.
Die grosse Schwäche der EU im Bereich der Legislativen hängt mit der Tatsache zusammen, dass man in einem Staatenverbund, der an sich noch weniger zentralistisch sein sollte als ein Bundesstaat, eine einzige schlecht legitimierte zentralistische Institution geschaffen hat, welche angeblich die auf den Verfassungsvertrag abgestützten allgemeinverbindlichen Gesetze erlässt. So wird einem Kontinent ein Zentralstaat aufgezwungen, dessen historisch-politische Strukturen höchstens eine nach aussen offene Freihandelsassoziation und allenfalls noch einen auf Frieden und gemeinsame Sicherheit ausgerichteten Staatenbund verkraften. Schon ein Bundesstaat mit einem funktionierenden Zweikammersystem, in dem die Kleinen, Bevölkerungsschwachen gleiche legislative Mitbestimmungsmöglichkeiten hätten wie die Grossen, wäre — anders als in den USA und in der Schweiz — in der EU nicht konsensfähig.
Das eigentliche Thema, das staatspolitisch analysiert und diskutiert werden müsste, ist nicht der Gegensatz von Rechtsstaat und Demokratie, sondern der offenbar unaufhaltsame Vormarsch des Richterstaats, der an die Stelle des klassischen Gesetzgebungsstaates tritt. Das rechtsstaatliche und das föderalistische Prinzip der checks and balances werden damit ausgehebelt.
Dieser Prozess ist nicht nur in der EU im Gange. Er lässt sich auch in der Schweiz beobachten. Das Bundesgericht übt immer weniger Zurückhaltung, wenn es Entscheide zu fällen hat, die politische Grundfragen betreffen und die auf einer weitgehend politischen Interpretation von Verfassungs- und Gesetzesgrundlagen beruhen. Wer sich mit den jeweiligen höchstrichterlichen Entscheiden identifiziert und im zunehmenden Zentralismus und Etatismus einen Fortschritt sieht, mag diese Entwicklung begrüssen, selbst wenn er an sich das Prinzip der Gewaltentrennung befürwortet. Aber die Zahl der Menschen, die an Prinzipien auch dann festhalten, wenn sie Resultate hervorbringen, die eigenen Auffassungen und Interessen widersprechen, ist ohnehin begrenzt. Viele sind für Demokratie, solange die Demokratie für sie ist, und für «mehr Demokratie» wenn sie damit Sukkurs für ihre eigenen politischen Anliegen wittern. Dasselbe gilt für den Rechtsstaat. Die schwammige Gegenüberstellung von Rechtsstaat und Demokratie ist darum so attraktiv, weil sie eine Prinzipientreue à la carte ermöglicht. Im Fall von Widersprüchen hat man mindestens eines der Prinzipien auf seiner Seite.
Der weltweit beobachtbare Trend, dass Verfassungsgerichte tendenziell gouvernemental, zentralistisch und auch wohlfahrtsstaatlich entscheiden, hat höchst komplexe Ursachen. Der Rechtsstaat ist im 20. Jahrhundert (dem Jahrhundert der Weltkriege) mit dem Sozialstaat faktisch verschmolzen worden. Sozialpolitisch motivierte Umverteilung, ursprünglich eine auf die finanziellen Möglichkeiten des Gemeinwesens abzustimmende Massnahme im Ermessensbereich, ist zu einem Bündel von Rechtsansprüchen umfunktioniert worden.
Der Berner Staatsrechtslehrer Walther Burckhardt hat in seinem Buch «Die Organisation der Rechtsgemeinschaft» (Basel 1927) auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Rechtssetzung und Rechtsanwendung hingewiesen. «Der wesentliche Unterschied zwischen Rechtssetzung und Rechtsanwendung ist also, dass Rechtssetzung neues Recht schafft, auf selbständigem Werturteil beruht, während die Rechtsanwendung nur die tatsächlichen Voraussetzungen des geltenden Rechts festsetzt und rechtlich nichts Neues schafft». Für Burckhardt geht das gesetzte Recht (aller Stufen) der Rechtsidee vor, und der Rechtsanwender darf daher seine eigenen diesbezüglichen Vorstellungen nicht in sein Urteil einfliessen lassen, auch nicht auf dem Weg der stets «gut gemeinten» Interpretation. Während in der EU diese Unterscheidung längst missachtet wird, gibt es in der Schweiz noch die Chance einer Rückbesinnung.
Publiziert in Schweizer Monatshefte
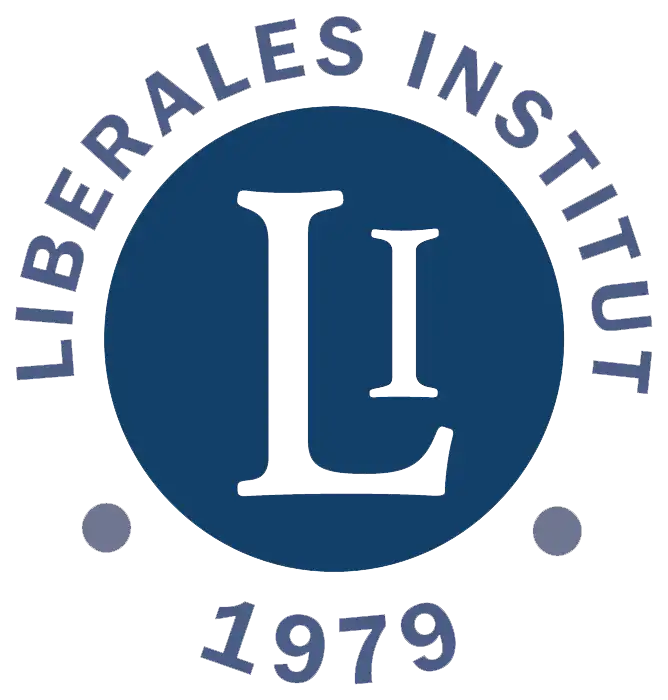
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.