
Korporatismus ist ein sperriger Terminus, der kaum in die heutige Begriffswelt der Ökonomen passt, zumindest wenn diese finanzmarktorientiert sind. Er erinnert aus der Ferne an den autoritären Ständestaat der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts mit Zwangsmitgliedschaft in Verbänden, an die Verfilzung von politischer und wirtschaftlicher Macht und die Ausschaltung von Wettbewerb. Die erste Assoziation zielt hingegen in eine ganz andere Richtung: Im internationalen Kapitalmarktgeschäft werden nämlich nichtstaatliche Industrieunternehmen, interessanterweise ohne Banken und Versicherungen, als Corporates bezeichnet.
Wird jedoch der Korporatismus der modernen Ausprägung mit „Sozialpartnerschaft“ gleichgesetzt, sieht das Bild wesentlich anders aus. Sozialpartnerschaft mit dem Hauptinstrument Gesamtarbeitsvertrag hat besonders in der Schweiz einen ausgezeichneten, fast schon magischen Klang und dürfte im Volk mindestens so beliebt sein wie die Neutralität — nicht zuletzt, weil die Rolle des Staates recht diskret ist. Wichtigster Grund für die Popularität ist wohl, dass die jahrzehntelange, ritualisierte Konfliktlösung und Verständigung zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften einerseits dem Arbeitnehmer eine gewisse Planungssicherheit verschafft und anderseits dazu geführt hat, dass hierzulande kaum gestreikt wird, obschon kein institutionalisiertes Mitbestimmungsrecht existiert. Dass die Schweiz in Bezug auf durch Streiks verlorene Arbeitstage international über Jahrzehnte brilliert, fixiert zum einen auch gegenüber Aussen das Bild der Stabilitätsinsel. Das ist für den weltweiten Vermögensverwaltungsplatz Nummer eins und damit die Gesamtwirtschaft nicht unwichtig. Zum anderen gelten in Streiks mündende Arbeitskonflikte in der Schweiz — nicht zu unrecht — als besonders nutzlose Verschwendung von Ressourcen, was die tiefverwurzelte Abneigung gegenüber dem Kampfmittel der Arbeitnehmer erklären mag.
Die Vermeidung von Streiks — Ausdruck einer effizienten und auch transparenten Koordination zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern — ist das sichtbarste Verdienst der Sozialpartnerschaft helvetischer Prägung, aber beileibe nicht ihr einziges. Jedenfalls scheinen ihre Errungenschaften nahezu unbestritten zu sein. Entsprechend stellt denn auch keine der grossen Parteien die Sozialpartnerschaft prinzipiell in Frage. Wenn es jedoch darum geht, den Begriff mit Inhalt zu füllen, endet die Harmonie. Während etwa die CVP die gelebte Sozialpartnerschaft als Erfolgsmodell bezeichnet und Arbeitgeber („Sozialpflicht“) sowie Gewerkschaften zu verantwortungsbewusstem Handeln mahnt, warnt die FDP eines links-grün-dominierten Stadtkantons vor einer „Verstaatlichung“ der Sozialpartnerschaft, namentlich der Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen und neuen gesetzlich verordneten tripartiten Kommissionen. Dass die linke Seite die Sozialpartnerschaft immer wieder gerne als Hebel für mehr staatlichen Einfluss auf die Wirtschaftswelt bis hin zur konjunkturellen Feinsteuerung einsetzt, kann nicht überraschen, entspricht dies doch exakt ihrer Rolle im politischen Spiel. Auf der anderen Seite können auch Liberale wenig gegen eine Sozialpartnerschaft einwenden, die frei von staatlichen Zwangsmitteln auf der Basis freier Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ohne Alleinvertretungsanspruch oder Ausschliesslichkeitsmechanismen gelebt wird — wobei zu prüfen wäre, ob eine Sozialpartnerschaft bar jeder staatlichen Beteiligung überhaupt noch als solche zu bezeichnen ist.
Ob die Sozialpartnerschaft oder eben der Korporatismus die Wohlfahrt eines Landes mehrt oder mindert, ist ein dankbares Forschungsgebiet — umso mehr, als der Korporatismus in den kontinentaleuropäischen Ländern über Jahrzehnte autochthon gewachsen ist und sich nicht über einen Leisten schlagen lässt. Dazu gesellt sich die Kardinalfrage der Kausalität. Entsprechend heikel sind denn auch Vergleiche verschiedener nationaler Systeme in Bezug auf die wirtschaftliche Wohlfahrt. Selbst dafür ist nicht ein einfacher Indikator zu finden. Alternativ etwa zum realen Wirtschaftswachstum pro Kopf kann auch die Arbeitslosenquote herangezogen werden. In puncto Beschäftigung sähe die Schweiz international sicher bedeutend besser aus als in Bezug auf das Wachstum.
Politökonomisch betrachtet bilden Arbeitgeber bzw. ihre Verbände und Arbeitnehmer bzw. ihre Gewerkschaften zwei wichtige Anspruchsgruppen gegenüber dem Staat. Naturgemäss divergieren ihre Interessen im Kernbereich, der Verteilung des Einkommens auf die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Allerdings sind diesem Gerangel gewisse Grenzen gesetzt: Den Arbeitern nützt ein demotivierter Arbeitgeber ebensowenig wie umgekehrt. Aus Sicht der Gewerkschaften und auch politökonomisch einigermassen pikant ist übrigens die nüchterne Feststellung, dass gewisse Kreise nichtorganisierter Arbeitnehmer, namentlich Manager und Investmentbanker, fähig sind, für ihre Arbeitsleistung eine markant höhere Entlöhnung herauszuholen, als die von Verhandlungsprofis gewerkschaftlich vertretenen. Besonders aufschlussreich sind Konstellationen, in denen die Sozialpartner die gleiche Position einnehmen. Dann ist zu analysieren, welche Motive auf beiden Seiten zum Schulterschluss geführt haben.
Ein wichtiger Anwendungsfall auf Bundesebene waren die bilateralen Verträge und dabei speziell die Personenfreizügigkeit. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und der Staat (Bund und Kantone) machten gemeinsam Front dafür. Was waren die Gründe für die seltsame Allianz in einem Kerngebiet, nämlich der künftigen Gestalt des Arbeitsmarkts? Etwas plakativ formuliert lautet die Antwort wie folgt: Für die Wirtschaftsverbände war es wichtig, mit der Öffnung über eine grössere Auswahl an qualifizierten Arbeitskräften zu verfügen. Im Vordergrund standen für sie nicht tiefere Löhne, weshalb sie die abstimmungstaktisch nicht ungeschickten „flankierenden Massnahmen“ gegen Lohn- und Sozialdumping akzeptierten. Vielleicht hatte der eine oder andere ordnungspolitisch nicht ganz unbedarfte Vertreter auch die Worte von Prof. Franz Jaeger im Ohr. Dieser rief dazu auf, nach einem „Ja“ in der Abstimmung den ganzen Regulierungszauber („die unsinnigen, beschäftigungsfeindlichen flankierenden Massnahmen — Kopien aus dem kaputtregulierten deutschen Nachbarland“) wegzuräumen. Aus ökonomischer Sicht sind die flankierenden Massnahmen tatsächlich grober Unfug, da sie die Arbeitsmarktöffnung umgehend durch mehr Arbeitsmarktregulation konterkarieren. Die Gewerkschaften ihrerseits ergriffen die Chance, die sie sahen, um die Arbeitsplatzsicherheit der organisierten Arbeitnehmer zu erhöhen. Aus ihrer Sicht sind die flankierenden Massnahmen durchaus ausbaufähig, tatsächlicher oder vermeintlicher Lohndruck ist das beste Argument für einen stärkeren Staat. Der Staat profitierte, weil seine Rolle als Aufpasser und Schiedsrichter im bisher vergleichsweise wenig regulierten Schweizer Arbeitsmarkt gestärkt wird. Zudem konnte er internationale Verträge abschliessen, was immer prestigeträchtig ist. Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und Behörden sahen erstens Vorteile für die Gruppen, die sie vertreten. Zum zweiten liefert die Umsetzung der flankierenden Massnahmen und die Überwachung des Arbeitsmarkts diesen Organisationen selber ein breites Betätigungsfeld und damit eine Legitimation. Keine Lobby hatten dagegen beispielsweise die Arbeitslosen und -suchenden — für deren Betreuung und Verwaltung ist wiederum der Staat zuständig. Damit wird nicht behauptet, dass die Personenfreizügigkeit wegen der flankierenden Massnahmen die gemeinsame Wohlfahrt der Schweiz mindert statt mehrt. Nur ist auch niemand imstande, für das eine oder andere Resultat eine Garantie abzugeben.
Problematisch scheint es also dann zu werden, wenn die Sozialpartner mit staatlicher Unterstützung Wettbewerb einschränken und damit verzerren. Dass die aufgesetzte Harmonie nach dem gewonnenen Abstimmungskampf nun allmählich zerbröckelt, ist kein Unglück, sondern zeigt nur, dass die zwei Gruppen eben unterschiedliche Interessen vertreten — eine Rückkehr zum gesunden Normalfall sozusagen. Daneben ist aus Sicht des prototypischen Bürgers, der das Gemeinwohl im Auge hat, grundsätzlich alles zu begrüssen, was die Macht der Interessengruppen beschränkt — allerdings müssen diese in ihrem Kerngeschäft, bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern z.B. der effiziente Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit durch die Erhaltung des Arbeitsfriedens, handlungsfähig bleiben. Zur Machtbrechung gehört die ganz und gar nicht revolutionäre, aber gleichwohl richtige Forderung, dass sich der Staat möglichst wenig einmischt und auf die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen beschränkt; aber auch letzteres selbstverständlich nur subsidiär zur freien Gesellschaft.
Peter Kuster ist Ressortleiter bei der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“.
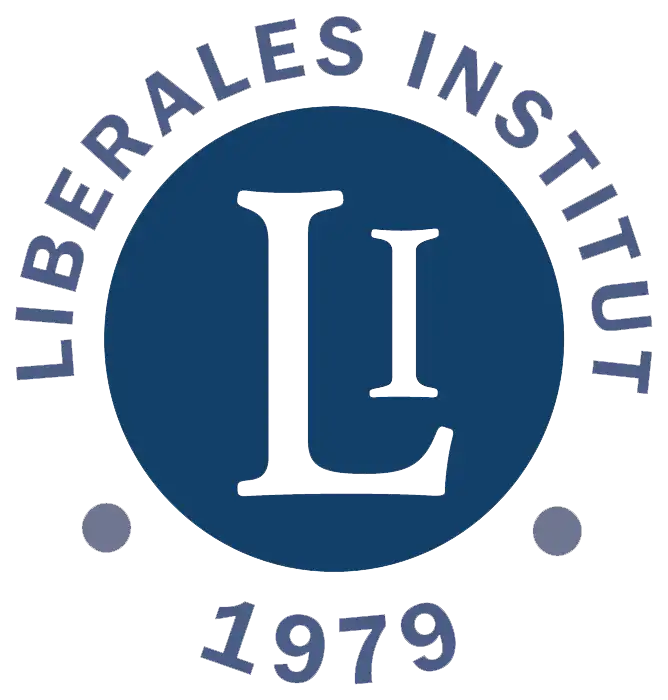
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.