
Seit vor rund hundert Jahren Walter Lippmanns Klassiker «Public Opinion» erschien, befasst sich die Wissenschaft mit Vorurteilen und Stereotypen. Die Forschung hat dazu Tausende Aufsätze und Bücher hervorgebracht. Besonders intensiv wurden rassistische und sexistische Vorurteile untersucht.
Sehr viel weniger Untersuchungen gibt es über Vorurteile, die auf der Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit basieren. Man spricht hier von Klassismus, analog zu Sexismus oder Rassismus. Inzwischen gibt es in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Arbeiten, die sich mit Vorurteilen über arme Menschen befassen. Bisher kaum untersucht wurden jedoch Vorurteile über eine Minderheit: die Reichen.
Die Social-Comparison-Forschung zeigt, dass wir uns andauernd — bewusst oder unbewusst — mit anderen Menschen vergleichen, um Informationen für unsere Selbstbewertung zu erhalten. Umgekehrt gilt: Wenn wir uns selbst bewerten, dann vergleichen wir uns mit anderen. Dieser Vergleich geschieht automatisch, weil wir uns nur im Vergleich mit anderen selbst wahrnehmen können. Neid kann entstehen, wenn sich Person A mit Person B vergleicht und Person B Eigenschaften, Güter oder Positionen besitzt, die Person A gerne hätte. Dass diese Vergleiche häufig unbewusst stattfinden, ist eine der Ursachen dafür, dass wir Neid gerne verdrängen.
Menschen versuchen, Neid zu reduzieren. Das kann geschehen, indem sie sich bemühen, die Lücke zwischen sich und dem Beneideten zu verkleinern. Gelingt das nicht, dann betont der Neider eigene Vorteile der Persönlichkeit, die auf einer anderen als der Vergleichsebene liegen. Der Neider kann beispielsweise sagen: Ich bin zwar nicht so reich wie X, aber dafür gebildeter oder warmherziger. Der Neider kann zudem die Felder, in denen er schlecht abschneidet, in ihrer Bedeutung herunterspielen, und jene Felder, in denen er gut abschneidet, herausstreichen.
Wenn soziale Gruppen andere Gruppen als ökonomisch erfolgreicher wahrnehmen, können ihre Angehörigen Kompensationsstrategien entwickeln, um ihr Selbstwertgefühl zu erhalten. Angehörige höherer sozialer Schichten können die Kriterien für die Rangordnung in einer Gesellschaft — beispielsweise wirtschaftlicher Erfolg oder Bildung — leichter akzeptieren, weil sie selbst oben in der Hierarchie stehen. Angehörige höherer sozialer Schichten neigen in stärkerem Masse dazu, sich aufgrund sozioökonomischer und kultureller Merkmale von anderen Gruppen abzugrenzen, während die Angehörigen unterer Schichten sich eher auf moralische Kriterien stützen.
Untersuchungen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland deuten darauf hin, dass «Nicht-Reiche» Kompensationsstrategien verfolgen, indem sie die Bedeutung von wirtschaftlichem Erfolg für die Lebenszufriedenheit infrage stellen und bestimmte Werte wie zwischenmenschliche Beziehungen, Moral oder Familienleben höher gewichten. Doch dabei bleibt es nicht. Um sich über die Reichen stellen zu können, muss diesen pauschal abgesprochen werden, dass sie in diesen Bereichen möglicherweise gleich gut (oder vielleicht sogar besser) sein könnten.
Die Stereotype, Reiche seien kalt, hätten ein schlechtes Familienleben oder ganz generell unbefriedigende zwischenmenschliche Beziehungen, seien egoistisch und hätten eine schlechtere Moral, dienen dazu, die eigene Überlegenheit zu postulieren.
Das Gemeinsame jener Dimensionen, über die Angehörige von «sozial benachteiligten» Schichten behaupten, besser zu sein als die Reichen, ist, dass sie sehr stark der subjektiven Deutung unterliegen. Beispielsweise ist nachweisbar, wer mehr Geld oder eine bessere Bildung hat; hier bleibt wenig Raum für Diskussion oder Interpretation. Anders verhält es sich mit der Frage, wer erfüllendere zwischenmenschliche Beziehungen unterhält oder bei wem das Familienleben besser funktioniert. Hier hängt die Antwort stark von der subjektiven Interpretation ab und ist für einen Aussenstehenden meist gar nicht erkennbar.
Die Institute Allensbach und Ipsos Mori führten im Mai und Juni 2018 eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und Frankreich mit identischen Fragestellungen durch. Da Sozialneid nicht mit direkten Fragen («Wie neidisch sind Sie?») gemessen werden kann, wurden den Teilnehmern drei Aussagen vorgelegt, die ein Indikator für Sozialneid sein können: «Ich fände es gerecht, wenn die Steuern für Millionäre stark erhöht würden, auch wenn ich dadurch persönlich keinen Vorteil hätte»; «Ich wäre dafür, die Gehälter von Managern, die sehr viel verdienen, drastisch zu kürzen und das Geld an die Angestellten der Unternehmen zu verteilen, auch wenn diese dadurch vielleicht nur ein paar Euro im Monat mehr bekämen»; «Wenn ich höre, dass ein Millionär mal durch ein riskantes Geschäft viel Geld verloren hat, denke ich: das geschieht dem recht».
Als «Nicht-Neider» werden jene bezeichnet, die keine dieser drei Fragen bejaht haben. Mit «Ambivalenten» sind jene gemeint, die eine der drei Aussagen unterstützen. Als «Sozialneider» werden jene bezeichnet, die zwei oder drei Aussagen unterstützen, wobei als «harter Kern» jene bezeichnet werden, die alle drei Aussagen bejahen. Zur Gruppe der Neider gehören in Deutschland 33 Prozent, in Frankreich 34, in den USA 20 und in Grossbritannien 18 Prozent. Da in allen Ländern die gleichen Fragen gestellt wurden, haben wir eine gute Vergleichsmöglichkeit.
Grundlage der Vergleiche ist der Sozialneidkoeffizient. Er gibt das Verhältnis von Neidern zu Nicht-Neidern in einem Land an. Ein Wert von eins würde bedeuten, dass die Zahl der Neider und der Nicht-Neider gleich gross ist. Bei einem Wert unter eins überwiegt die Zahl der Menschen, die keinen ausgeprägten Sozialneid empfinden, bei einem Wert von über eins überwiegt die Zahl der Menschen mit ausgeprägtem Sozialneid.
Der Sozialneidkoeffizient ergibt sich, wenn die Gruppe der Sozialneider (= zwei oder drei Fragen bejaht) zur Gruppe der Nicht-Neider (= keine Frage mit Ja beantwortet) in Relation gesetzt wird. Danach ist der Sozialneid in Frankreich mit 1,26 am grössten, es folgt Deutschland mit 0,97. In den USA (0,42) und Grossbritannien (0,37) ist er deutlich geringer.
Die Trennschärfe dieser Kategorien zeigt sich vor allem darin, dass sich die so ermittelten Gruppen der Neider und der Nicht-Neider auch bei der Positionierung zu Dutzenden weiteren Aussagen deutlich unterscheiden. So wurden von der Gruppe der Neider als häufigste Persönlichkeitsmerkmale der Reichen Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Materialismus, Überheblichkeit, Gier, Gefühlskälte und Oberflächlichkeit genannt.
Nur 2 der 25 Persönlichkeitsmerkmale, die Sozialneider am häufigsten nannten, sind positiv, 23 dagegen negativ. Häufigste Persönlichkeitsmerkmale der Reichen aus Sicht der Gruppe der Nicht-Neider waren dagegen Fleiss, Intelligenz, Wagemut, Materialismus, Einfallsreichtum und visionäres Denken.
Eine Frage diente dazu, herauszufinden, wie anfällig die Menschen in den vier Ländern für Sündenbockdenken sind. Den Befragten wurde folgende Aussage vorgelegt: «Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind schuld an vielen Problemen auf der Welt, etwa an Finanzkrisen oder humanitären Krisen.» In Deutschland ist die Zustimmung zu dieser Meinung mit 50 Prozent doppelt so hoch wie in Grossbritannien und den USA (25 und 21 Prozent).
Das lässt vermuten, dass sich Aggressionen gegen Reiche und die Bereitschaft der Politik, gegen diese vorzugehen, in einer akuten Finanz- oder Wirtschaftskrise in Deutschland eher mobilisieren liessen als in den angelsächsischen Ländern. In Frankreich liegt die Zustimmung bei 33 Prozent.
Insbesondere die Gruppe der Neider ist äusserst anfällig für Sündenbocktheorien, was belegt, wie gut die Sozialneidskala zwischen Neidern und Nicht-Neidern unterscheidet. In Deutschland neigen 62 Prozent der Neider, aber nur 36 Prozent der Nicht-Neider zum Sündenbockdenken.
In den anderen Ländern verhält es sich ähnlich. Diejenigen, die dem Sündenbockdenken anhängen, neigen auch stärker zum Nullsummenglauben. «Je mehr die Reichen haben, desto weniger bleibt für die Armen übrig»: Dem stimmen Mehrheiten der Sündenbockdenker in allen vier Ländern, also in Deutschland (60 Prozent), Frankreich (69 Prozent), Grossbritannien (57 Prozent) und den USA (65 Prozent), zu — aber nur 35, 41, 30 und 24 Prozent von jenen Befragten, die nicht dem Sündenbockdenken zuneigen.
Ein wichtiges Ergebnis der Befragung lautet, dass junge Amerikaner den Reichen deutlich skeptischer gegenüberstehen als ältere — in europäischen Ländern verhält es sich umgekehrt.
In bisherigen Befragungen zur Einstellung gegenüber Reichen wurden diese meist als homogene Gruppe behandelt. Tatsächlich unterscheidet sich jedoch die Einstellung der Bevölkerung je nachdem, wie Reiche ihren Reichtum erworben haben. In den vier Ländern wurde gefragt: «Manchen Leuten gönnt man es ja, wenn sie reich sind, bei anderen findet man das unverdient. Welche Personengruppen von dieser Liste haben es Ihrer Meinung nach verdient, wenn sie reich sind?»
In allen Ländern stehen Unternehmer und Selbständige an der Spitze, und man gönnt es auch Kreativen (Musikern, Künstlern), Spitzensportlern und Lottogewinnern, wenn sie zu Reichtum gelangen. Finanzinvestoren, denen Amerikaner und Briten es ebenfalls gönnen, kommen dagegen in Deutschland auf den vorletzten Platz des Rankings und liegen auch in Frankreich weit hinten.
Können Reiche ihr Image wenigstens aufbessern, wenn sie für wohltätige Zwecke spenden? Reiche, die das glauben, werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass ihnen in allen Ländern auch beim Spenden eher eigennützige als altruistische Motive unterstellt werden — also beispielsweise Steuern zu sparen oder ihren Ruf zu verbessern.
In einer Hinsicht, auch dies zeigt die Befragung, verhält es sich bei Reichen so wie bei anderen Minderheiten auch: Der unbekannte, fremde Reiche ist den meisten Menschen eher suspekt — der Reiche, den man persönlich kennt, wird dagegen sehr viel positiver beurteilt und entspricht so gar nicht den verbreiteten Stereotypen.
Der Autor war Gastreferent am LI-Gespräch vom 4. März 2019. Dieser Beitrag erschien in der NZZ vom 12. März 2019. Mit freundlicher Genehmigung.
Tags:
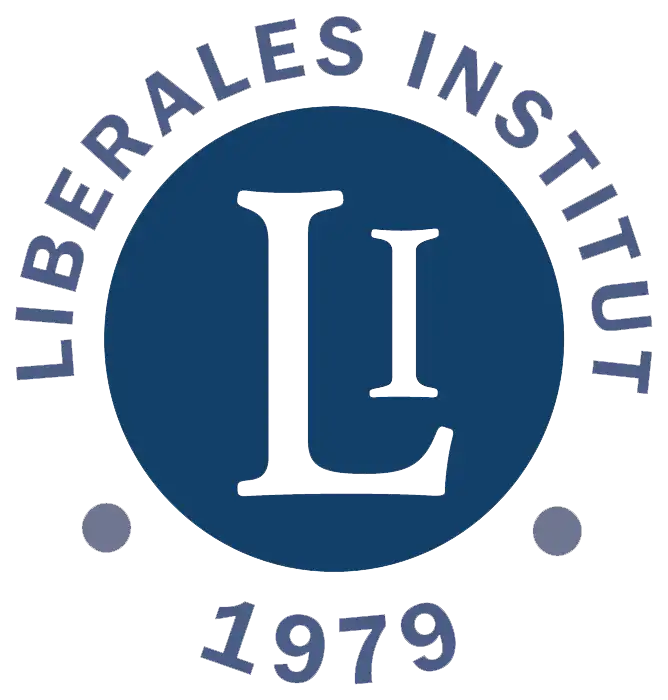
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.