
«What should we do about Africa?», wurde June Arunga, eine junge, selbständige Unternehmerin aus Kenia, unlängst nach einem Referat in Zürich gefragt. Die Antwort kam sofort. «If you want to help, stop helping, please.» Also Afrika sei nur ohne Hilfe zu helfen.
Entwicklungshilfe, wie wir sie noch heute kennen, ist ein Kind der Dekolonialisierung und des Kalten Krieges. Das altruistische Motiv, den jungen Staaten des Südens auf die Beine zu helfen, ging schon damals mit einem weniger altruistischen Kalkül einher: Man erkaufte sich die ideologische Bündnistreue lokaler Eliten durch finanzielle Zuschüsse und Sachleistungen — bis hin zu Panzern und Raketen.
In der Folge ging es meistens auch um wirtschaftlichen Fortschritt; der tatsächliche Entwicklungsstand der Nehmerländer indessen wollte den Theorien der Geberländer partout nicht folgen. Also galt es, neue Theorien zu ersinnen, neue Paradigmen und Modelle — keynesianische, marxistische, neoklassische und andere mehr.
In regelmässigen Abständen wurden überdies umfassende Grossrettungspläne produziert: 1969 bei der Weltbank unter Robert McNamara, 1980 im Nord-Süd-Report unter Willy Brandt, 1992 am Erdgipfel von Rio. Big-Push-Philosophien solcher Art treiben noch heute ihre Blüten, man denke an Tony Blairs Commission for Africa, an den Stufenplan der Europäischen Union, an die Millenniumsziele der Vereinten Nationen. Diese ehrgeizigste aller Entwicklungsoffensiven will das Ausmass der Hilfe bis 2015 verdreifachen und die extreme Armut auf der Welt dadurch halbieren.
Offen bleibt, wie auch dieser jüngste Masterplan auf der Grundlage eines Denkansatzes funktionieren soll, der seit einem halben Jahrhundert versagt, jedenfalls nicht die erhofften Ergebnisse zeitigt. Im Kern steht jenes altbekannte Element europäischer Aufklärung, das zur wichtigsten Triebkraft westlicher Modernität werden sollte, nämlich der Glaube an die Möglichkeit rationaler Weltbeherrschung.
Auch «Entwicklung» lässt sich in dieser Sicht planen, rechnen und von aussen induzieren. Von einer eigentlichen «Machbarkeitsobsession» hat der deutsche Afrikakenner Bartholomäus Grill unlängst gesprochen und eine Entwicklungsindustrie beschrieben, die sich unter der Flagge der Wohltätigkeit längst zu einem Milliardengeschäft verselbständigt hat. Je mehr Geld, desto besser.
Woher kommt es, dass der reiche Norden mit so viel Eifer helfen will? Die Palette plausibler Erklärungen reicht vom schlechten Gewissen des weissen Mannes über aufgeklärtes Eigeninteresse des Homo oeconomicus bis hin zur Gesinnungsethik wohlwollender Menschen. Tatsache ist, dass auch das stärkste Motiv den Unterschied zwischen «helfen wollen» und «helfen können» nicht wird aufheben können. Entwicklung lässt sich nicht von aussen «machen». Wie andere soziale Prozesse auch, ist sie von einer Komplexität, die unserem Verstehen nur in Grenzen zugänglich ist.
Zu viele Parameter sind nicht steuerbar, verändern sich aber permanent und modifizieren die Anreizstrukturen der beteiligten Akteure. Was Wunder, wenn auch vermeintlich erfolgreiche Projekte zuletzt halt doch das schiere Gegenteil von dem bewirken, was beabsichtigt war.
Routiniert revidieren multilaterale, staatliche und private Agenturen in solchen Fällen Strategie und Vokabular — und wissen weiterhin zu wenig, viel zu wenig auch über die sozialen und kulturellen Eigenheiten ihrer Einsatzgebiete. Aberglaube und andere «irrationale» Entwicklungshemmnisse werden ignoriert, über Mentalitätsbarrieren wird aus Gründen der politischen Korrektheit gar nicht gesprochen. Lieber verlässt man sich auf die eigene, rational entwickelte und akademisch gestützte Prioritätenmatrix — und entwickelt unverdrossen weiter.
Nicht alles ist sinnlos, nicht alles ist schlecht. Insgesamt fällt die Bilanz dennoch erschütternd aus. Seit Jahren rechnen afrikanische Wirtschaftswissenschafter den Geberländern vor, dass ihre Geldströme lokale Elite korrumpieren, dass sie Staat und Politik aufblähen. Die unmittelbarste und schwerwiegendste Folge des leichten Geldes aber ist, dass es eine Rentenökonomie am Leben hält, die jede produktive Eigeninitiative lähmt und den Aufbau wettbewerbsfähiger Strukturen recht eigentlich verhindert.
«Keine Hilfe» also? — June Arunga relativiert mit einer schlichten, aber explosiven Formel: «trade not aid». Handel statt Hilfe. Sie wünscht sich europäische Nachbarn, die nicht zu wissen glauben, was gut ist für die anderen; bescheidene Nachbarn, die nicht länger versuchen, anderswo nach eigenem Vorbild Zustände zu schaffen; sie hofft auf faire Partner, die Austauschprozesse zulassen und dafür ihre Märkte öffnen.
Nur mit solchen Nachbarn, schliesst die junge Frau, kann auch ein Kontinent wie Afrika endlich darangehen, seine Probleme selber zu lösen. Dem ist nichts hinzuzufügen — ausser der Befürchtung vielleicht, dass June sich wird gedulden müssen.
June Arunga sprach am 9. November 2007 am Liberalen Institut zum Thema «Free Markets – Hope for Africa». Dieser Artikel wurde im St. Galler Tagblatt vom 14. Juni 2008 veröffentlicht. Das Liberale Institut bedankt sich beim Autor für die freundliche Genehmigung zur weiteren Veröffentlichung.
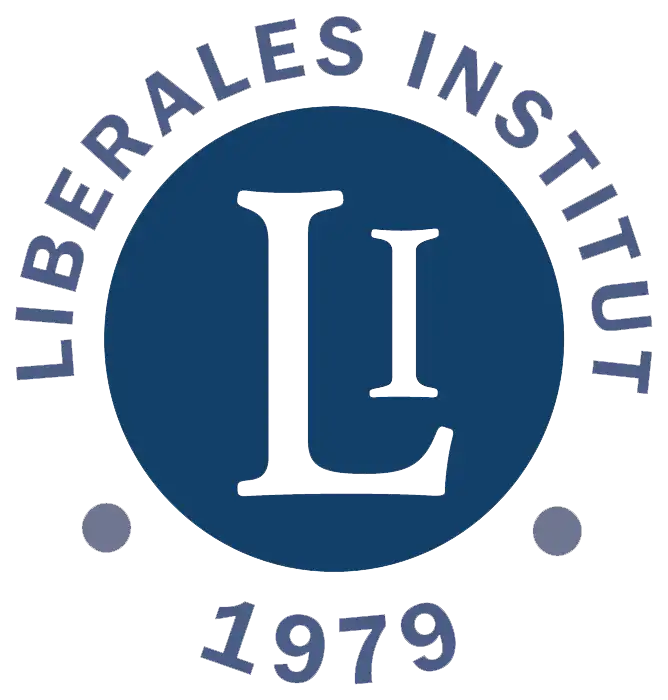
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.