
Die Politik liebt Krisenzeiten. Viele Menschen befinden sich dann in einem aufgeregten Zustand, haben Angst und sind eher bereit, Eingriffe in ihre individuellen Freiheitsrechte zu erdulden. Historisch kann gut beobachtet werden, wie Staaten insbesondere in solchen Zeiten ihre Macht zulasten der Bürgersouveränität ausgebaut haben — etwa nach 9/11, als die staatlichen Überwachungsapparate massiv ausgebaut oder im Zuge der Finanzkrise 2008, als die Finanzmärkte in regulatorische Fesseln gelegt wurden.
Krisen und die politischen Reaktionen darauf sind deshalb so problematisch, weil der Staat sich kaum jemals wieder vollständig aus jenen Tätigkeitsfeldern zurückzieht, in denen er sich einmal festgesetzt hat. Die Kriegsabgabe etwa, die während des Ersten Weltkriegs als «vorübergehende Notmassnahme» eingeführt wurde, besteht auch noch über 100 Jahre danach in Form der direkten Bundessteuer. Der Fehler von John Maynard Keynes Theorie der antizyklischen Staatseingriffe zur Ankurblung der Wirtschaft liegt im Irrglauben, dass sich der Staat bei guter Wirtschaftslage automatisch wieder zurückziehe.
Es gilt also ganz genau zu beobachten, wo sich der Staat im Zuge der aktuellen Notlage überall in die freie Koordination der Menschen einmischt — um nach Beendigung der speziellen Situation unmittelbar wieder auf eine Rückkehr zur Normalität zu pochen. Dieses Vorhaben dürfte jedoch alles andere als leicht sein. In den kommenden Wochen werden sich diverse Sonderinteressen sortieren, organisieren und von der Politik Folgemassnahmen fordern, welche die freie Marktwirtschaft zusätzlich auszuhöhlen drohen, wie etwa Konjunkturpakete in Form von staatlichen Investitionen. LI-Vizedirektor Olivier Kessler zeigt in der «Neuen Zürcher Zeitung» auf, weshalb man die Finger davon lassen sollte.
Den Artikel lesen:
Der Notstand und die Versuchung einer Sonderinteressen-Politik
(3 Seiten, PDF)
Tags:
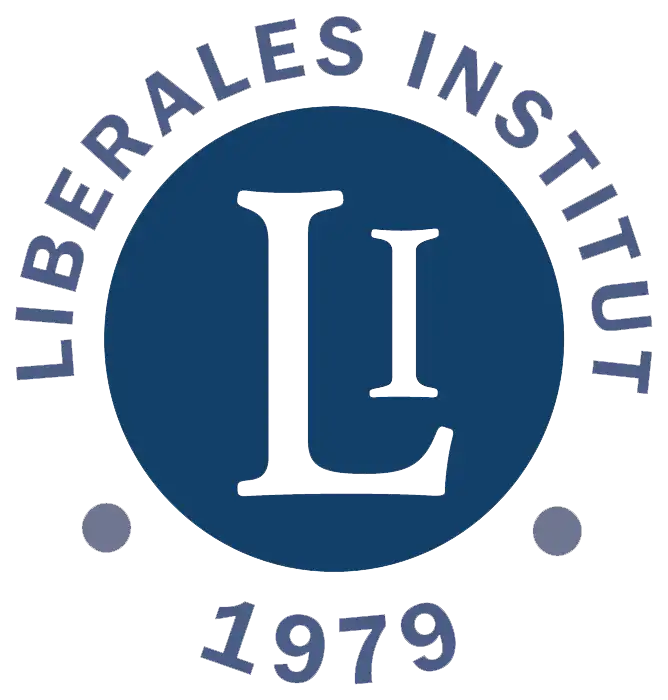
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.