
Die Versorgung mit Gütern auf dem freien Markt funktioniere nur dort, wo es eine genügend grosse Kundschaft gebe. Die Schweiz sei jedoch ein zu kleiner Markt. Insbesondere in abgelegenen Dörfern gäbe es ohne staatliche Unterstützung beispielsweise keine Post-Services, keine Verkehrsdienste und keine Medien. Deshalb müsse hier der «Service public» — also zwangsfinanzierte Betriebe — einspringen. So zumindest lautet die geläufige Begründung für das staatliche Eingreifen in diverse Märkte.
Es mag korrekt sein, dass es in Randregionen mit weniger Einwohnern eine mengenmässig geringere Nachfrage nach Medien, Post- und Verkehrsleistungen gibt. Doch dies bedeutet noch lange nicht, dass diese Dinge dort nicht auch profitabel auf dem freien Markt angeboten werden könnten. Letztlich besteht auch in den Randregionen eine entsprechende Nachfrage. Es gibt also kein Grund anzunehmen, dass diese Leistungen dort a priori nicht erbracht werden könnten. Ob ein Service gewinnbringend angeboten werden kann, ist letztlich einzig eine Frage der Zahlungsbereitschaft der Kunden.
Es leuchtet ein, dass solche Leistungen in abgelegenen Bergregionen etwas teurer sein dürften als in gutbelebten Städten oder Agglomerationen, weil zum Beispiel der Anfahrtsweg für den Pöstler etwas weiter ausfällt und die Nachfrage nach Bus- und Zugfahrten zahlenmässig geringer sein dürften.
Doch in abgelegenen Regionen, auf einem Berg oder in einem verlassenen Tal zu leben ist eine freiwillige Entscheidung, die aus persönlichen Abwägungen getroffen wird. Wer das tut, erfreut sich dort vielleicht an einer höheren Umweltqualität, einer sauberen Luft, mehr Ruhe, einer idyllischen Aussicht und dem Gefühl, näher an der Natur zu sein. Ausserdem sind in abgelegenen Dörfern oftmals die Liegenschaftspreise, wie auch die Wohn- und Lebenshaltungskosten niedriger, weshalb ein solcher Entscheid auch aus ökonomischen Überlegungen getroffen worden sein mag.
Es ist alles andere als notwendig und schon gar nicht gerecht, der restlichen Bevölkerung, die nicht von diesen Vorteilen profitiert, zwangsweise ihr Geld abzunehmen, um den Menschen in diesen Regionen ihre Postleistungen, Medien und Fahrdienste zu subventionieren, um sie dort zu den gleichen Preisen anbieten zu können wie in den Städten.
Die Subventionierung abgelegener Gegenden und Kantone ignoriert, dass es sich bei diesen Gebieten nicht um Entwicklungsländer und Armutszonen handelt, die ohne die Subventionen nicht überleben könnten. Oftmals befinden sich in diesen Gebieten auch Kurorte sowie Ski- und Wanderressorts — also touristische Hotspots, mit denen die lokalen Anbieter viel Geld verdienen können. Diese Regionen haben keine Unterstützungsgelder nötig, um zu überleben und zu gedeihen. Vielmehr bremst man deren Entwicklung durch diese innerstaatliche «Entwicklungshilfe», weil man lokale und innovative Anbieter durch den «Service public» aus dem Markt drängt, die die gleichen Dienstleistungen oftmals besser und innovativer als ein staatlich finanzierter Player hätten erbringen können. Selbst wenn die privaten Akteure die Ressourcen effizienter und zielgerichteter einsetzen — also bessere Arbeit leisten —, haben sie gegen die reichlich mit Zwangsbeiträgen ausgestatteten staatsnahen Betriebe schwer zu kämpfen, die sie mit unverhältnismässigen Summen aus dem Märkt drängen.
Aufgrund der diversen Vorteile, die Menschen in Randregionen geniessen, wären etwas höhere Marktpreise für Post, Medien und Verkehrsdienste durchaus vertretbar. Ansonsten wäre es auch eine Variante, tiefere Marktpreise zu bekommen, indem man die Anforderungen etwas herunterschraubt. So könnte die Abholung bei gelben Briefkästen beispielsweise nur einmal täglich organisiert werden, anstatt wie in den Städten mehrmals. Auch wäre es eine Variante, keine Postschalter vor Ort zu haben, um Personalkosten einzusparen. Pakete könnte man dann bei einem lokalen Geschäft abgeben, das von der Post dafür entschädigt wird. Es ist also nur eine Frage des Preis-Leistungsverhältnisses, nicht eine Frage des «ob». Denn wo eine Nachfrage existiert, da dürften auch Angebote entstehen, weil dies für Marktakteure eine potenzielle Gewinnmöglichkeit darstellt.
Doch warum nicht einfach alles so belassen wie es ist? Was ist am «Service public» überhaupt auszusetzen? Im Grunde genommen eine ganze Menge. Auf den Aspekt der Ethik sind wir bereits zu sprechen gekommen: Woher nehmen sich der Staat oder eine allfällige Stimmmehrheit ihre Legitimation, den Bürgern ihr Eigentum zu bestreiten und dieses für Services einzusetzen, die diese gar nicht freiwillig in dieser Form, Qualität oder Menge nachfragen? Eine solche Gewaltausübung erscheint unter jederlei Hinsicht unhaltbar und wäre unverzüglich zu stoppen.
Ein weiteres Problem ist, dass «Service public»-Unternehmen nicht den Gesetzmässigkeiten des freien Marktes unterliegen. Für sie gilt das Gewinn-Erfordernis, das allen privaten Unternehmen zugrunde liegt, nicht. Ihnen fliessen die Einnahmen (über den Umweg der staatlichen Zwangsumverteilung) unabhängig davon zu, ob die Kunden zufrieden sind oder nicht. Sie verhalten sich in der Folge oftmals alles andere als kundenfreundlich, weil sie es sich leisten können, sich nicht um deren Meinungen zu scheren.
Für privat operierende, im Wettbewerb stehende Unternehmen wäre eine konstante Missachtung der Kundenbedürfnisse undenkbar. Tagtäglich haben sie um den Vorzug und die Gunst der Kunden zu weibeln. Sie müssen diese mit guten Leistungen, Kundenfreundlichkeit und attraktiven Preisen von sich überzeugen.
Weil «Service public»-Anbieter keine Rücksicht auf den Willen der Konsumenten nehmen müssen, können sie es sich auch leisten, beliebige Preise zu verlangen — und das selbst für Leistungen, die die Kunden gar nicht in Anspruch nehmen. So haben alle Haushalte beispielsweise Radio- und TV-Zwangsgebühren zu bezahlen (plus jenen Anteil, den sie indirekt von der Mediensteuer für Unternehmen mittragen müssen), auch wenn sie diese Angebote gar nicht benutzen und anstatt dessen lieber private Medien konsumieren oder ihr Geld für Dinge ausgeben, die sie als prioritärer erachten.
Auch andere «Service public»-Betriebe wie die SBB können es sich leisten, ihre Ticketpreise ständig zu erhöhen, obwohl die Preise bereits zu rund zwei Dritteln vom Steuerzahler subventioniert werden und der Leistungsumfang gefühlt ständig abnimmt: Während beispielsweise in den S-Bahnen früher noch Abfalleimer bei jedem Sitzplatz montiert waren, wurden diese mittlerweile in vielen Zügen entfernt, was für den Kunden weniger Komfort bedeutet. Auch war es früher in diesen Bahnen noch möglich, Koffer über den Sitzplätzen zu verstauen, während die neueren Modelle nur noch einen derart lächerlichen Platz lassen, dass dort höchstens noch eine Jacke hineingepresst werden kann.
Marktwirtschaftliche, private Lösungen sind in jedem Fall staatlichem Zwang vorzuziehen, weil sie einerseits in der Regel kundenorientierter, kundenfreundlicher, preiswerter und qualitativ besser sind, und andererseits auch den individuellen Willen der Bürger respektieren.
Olivier Kessler ist Direktor des Liberalen Instituts in Zürich.
Tags:
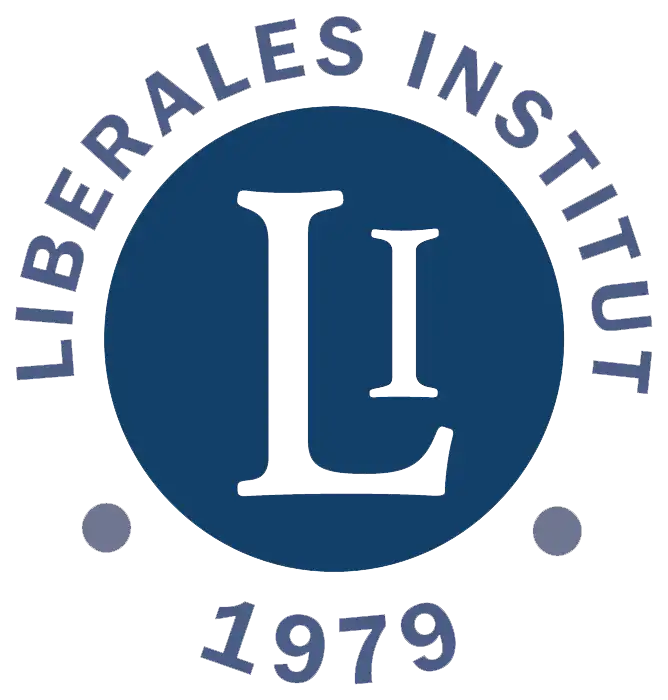
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.