
Der Staat vertrete in einer Demokratie als unbefangene und selbstlose Instanz die Interessen der Staatsbürger. Alles, was er tue, repräsentiere den Willen der Gesellschaft. Was hat es mit diesem Klischee auf sich?
Die Logik hinter diesem Klischee geht folgendermassen: Das politische Personal wird in Demokratien von der Bevölkerung bestellt, weshalb nur Leute gewählt werden, die die Interessen dieser Allgemeinheit vertreten. Was bei dieser Argumentation allerdings ignoriert wird sind 1.) die Eigeninteressen der gewählten Politiker, 2.) die Eigeninteressen der Verwaltung, 3.) die Einflussnahme gutorganisierter Partikularinteressen, 4.) die schiere Bedeutungslosigkeit der politischen Partizipation eines Individuums, 5.) die Möglichkeit schlechter politischer Entscheide, die dem Allgemeinwohl schaden und für das politische Personal dennoch kaum Folgen haben, und dass es 6.) für den Staat – einmal abgesehen von einigen wenigen allgemeingültigen Regeln – gar nicht möglich ist, die Interessen aller Bürger zu vertreten. Doch alles der Reihe nach.
Erstens: Auch Politiker verfolgen Eigeninteressen, die den Interessen der Bürger oftmals entgegengesetzt sind. Diese legen sie nicht einfach ab, wenn sie in ein öffentliches Amt gewählt werden. Wissenschaftlich mit diesen Verhältnissen befasst sich die Public Choice-Schule. Zu den wichtigsten Eigeninteressen von Politikern zählen ihre Wiederwahl, ihr Ansehen, ihre Karriere und die Maximierung ihrer Entschädigungen und ihres Einflussbereichs.
So versuchen sich Politiker etwa durch medial inszeniertes Vorpreschen mit immer neuen Vorstössen für die nächsten Wahlen zu profilieren. Solche Vorstösse werden oftmals nur aus einem Affekt heraus eingereicht, um politisches Kapital aus einer aktuellen öffentlichen Diskussion zu schlagen, jedoch nicht, um ein gerechteres System herbeizuführen oder das Allgemeinwohl besser zu befriedigen.
Ein weiteres Beispiel für das offensichtliche Verfolgen von Eigeninteressen sind die exzessiven Parlamentarierentschädigungen, welche sich das Parlament auf Kosten der Steuerzahler selbst zuspricht. Diese liegen weit über dem Durchschnittseinkommen der Bevölkerung – in der Schweiz bei 126 986 Franken für einen Nationalrat und 143 030 Franken für einen Ständerat (Stand 2020), womit Parlamentarier für eine Teilzeitstelle zu den absoluten Spitzenverdienern im Lande gehören. Nur 9 Prozent der Männer und 2,5 Prozent der Frauen in der Schweiz verdienen mit einer Teilzeittätigkeit (ein Arbeitspensum von weniger als 90 Prozent) über 104 001 Franken.
Zweitens: Eine ähnliche Logik herrscht bei Verwaltungsmitarbeitern – also den Ausführungsorganen des Staates. Auch sie verfolgen eigene Interessen, wie die Public Choice-Schule darlegt. Von Beamten angestrebt werden beispielsweise Budgeterhöhungen für diejenigen Bereiche, für die man tätig ist. Dies macht nicht nur den eigenen Arbeitsplatz sicherer, sondern dient auch der persönlichen Karriereförderung. Die Dauer für die Erledigung einer Arbeit lässt sich in Verwaltungen grundsätzlich beliebig ausdehnen, weil beim Staat die Disziplin des Marktes in Form eines Rentabilitätserfordernisses fehlt. Daher ist es für Beamte in leitenden Positionen ein Leichtes, eine angeblich steigende Arbeitslast zu behaupten und so weitere Untergebene als Hilfskräfte anzustellen. Was damit in Tat und Wahrheit verfolgt wird, ist oftmals die Absicht, die eigene Wichtigkeit und das eigene Prestige zu vergrössern sowie Aufstiegschancen zu schaffen, denn je mehr Untergebene ein Bürokrat vorweisen kann, desto grösser werden seine eigenen Chancen, in der Verwaltungshierarchie aufzusteigen.
Behörden haben zudem kein Interesse daran, ein Problem, zu deren Lösung sie beauftragt wurden, effektiv zu lösen. Ansonsten laufen sie Gefahr, überflüssig zu werden. Eine beliebte und oft praktizierte Möglichkeit zur Anhäufung des bürokratischen Einflussgebietes ist daher die Verstaatlichung und Regulierung immer weiterer Lebensbereiche – was auf Kosten der Freiheit der Bürger geht.
Drittens: Politik bedeutet zudem vielfach auch die Verfolgung von Sonderinteressen spezifischer Individuen oder Gruppen, die zwar nicht in Politik oder Verwaltung tätig sind, die aber ihre Eigeninteressen dennoch auf Kosten der Steuerzahler zum Allgemeinwohl hochstilisieren. Diese Partikularinteressen organisieren sich als Lobbys (Landwirtschaft, Gewerkschaften, Tourismusförderung, Medien, Umweltverbände etc.), um gesetzliche Privilegien zu erlangen. Weil die Vorteile für Partikularinteressen konzentriert und die Kosten für die unorganisierte zahlende Allgemeinheit verstreut sind, regt sich dagegen selten Widerstand.
Viertens: Das Argument, dass jeder Bürger «partizipieren» könne, wenn er mit dem Staatswesen unzufrieden ist, ist scheinheilig: Politische Partizipation ist sehr kostspielig und zeitaufwändig. Eine Stimme unter 5,3 Millionen Stimmberechtigten hat im Vergleich zu einem Individualentscheid praktisch keinen Einfluss.
Fünftens: Es ist ein Mythos, dass immer nur die Klügsten und Fähigsten in politische Führungsposten gewählt werden, die nach reiflicher Überlegung und nach Abwägung von Pro und Contra zu einer wohlüberlegten Entscheidung gelangen, welche Lösung letztlich für die Bürger die beste wäre. Der Psychologe und Anthropologe Gustave Le Bon schreibt in seinem Werk Psychologie der Massen, dass jene charismatische politische Führungsfiguren die erfolgreichsten seien, die intellektuell beschränkt, nicht zur Reflexion in der Lage und völlig von ihren Ideen überzeugt sind. Dadurch könnten sie die Massen viel glaubwürdiger mitreissen. Wenn das politische Führungspersonal jedoch durch eine solche natürliche Auslese bestellt wird, ist dies nicht gerade ein Garant für gute Ergebnisse. Politiker und Verwaltungsangestellte – und auch Bürgermehrheiten – treffen denn auch oftmals Entscheide, die dem Allgemeinwohl nachweislich schaden, beispielsweise das Gutheissen von kontraproduktiven Gesetzen, Steuer- und Ausgabenerhöhungen, Umverteilungen zulasten von Minderheiten sowie Eingriffe in die Eigentumsgarantie oder in die Privatsphäre.
Sechstens: In einer pluralistischen Gesellschaft gibt es ein «Allgemeinwohl» nur in Bezug auf allgemeingültige Regeln des Miteinanders. Konkret: die Rechtsgleichheit, das Recht auf Leben und persönliche Freiheit, Meinungs- und Glaubensfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie. Darüber hinaus gibt es nur individuelle Präferenzen und Bedürfnisse, die sich oftmals widersprechen und ausschliesslich auf privatrechtlichem Weg miteinander in Einklang gebracht werden können. Der Staat könnte daher über diese allgemeingültigen Regeln hinaus nicht einmal theoretisch alle gleichermassen vertreten.
Auch wenn historisch liberale Verfassungen im Sinne des Allgemeinwohls in Ländern wie der Schweiz und den USA eingeführt wurden, führt der Zwangscharakter staatlichen Handelns sehr rasch zu einem Missbrauch politisierender Prozesse und zu Sonderprivilegien von besonders mächtigen Interessengruppen.
Nur ein auf seine Grundfunktionen begrenzter Staat kann den Anspruch erheben, allen Einwohnern gleichermassen zu dienen. Davon sind wir heute leider weit entfernt, weshalb der Staat eben bei weitem nicht «wir alle» sind.
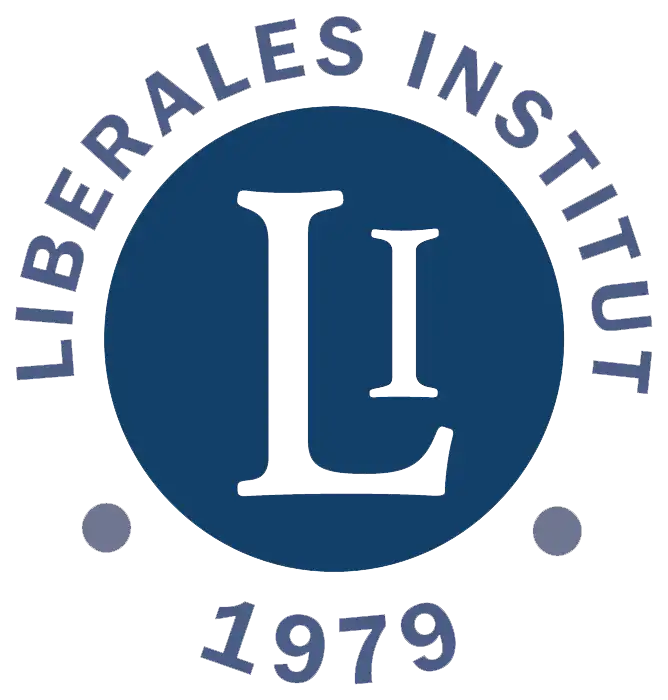
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.