
2009 war ein schwieriges Jahr, obwohl es die Auguren am Ende mit zuversichtlichen Prognosen in milderes Licht getaucht haben. In der Schweiz fand die jahrzehntealte Gewissheit, dass die finanzielle Privatsphäre nur in Ausnahmefällen aufgehoben wird, ein Ende. Und weltweit ist den Menschen zunehmend klargeworden, was sie die Bekämpfung der Wirtschaftskrise kosten wird. Zugleich hat dies auch die Herausforderungen der Altersvorsorge wenn nicht verschärft, so doch deutlicher hervortreten lassen.
Der Bevölkerung dämmert langsam, wie sehr das vollmundige Versprechen, die Renten seien sicher, auf der trügerischen Erwartung ständigen Wachstums fusste. Die Kosten der Alterung in den Industriestaaten dürften gemäss IMF etwa zehnmal so hoch sein wie jene der Bewältigung der Finanzkrise — wobei mit letzteren vor einigen Jahren kaum jemand rechnen konnte, während erstere seit Jahren erkennbar sind, aber von der Politik unter den Teppich gekehrt wurden. Dazu kommen weitere Probleme des Ausstiegs aus der wirtschaftspolitischen Brandbekämpfung, allen voran die Gefahr, dass eine unheilige Allianz aus überschuldeten Staaten, Unternehmen und Privathaushalten das Heil in einer Inflationierung suchen könnte.
Ob solch düsterer Langfrist-Perspektiven ist es verständlich, dass Zorn über die Krise und das Versagen einzelner Exponenten der Wirtschaft weit verbreitet ist. Kein Wunder auch, dass diese Stimmungslage ein gefundenes Fressen für Populisten ist, in der Politik wie in den Medien, die die Emotionen der Menschen schüren und illusionäre Lösungen vorgaukeln. Die meisten von ihnen kann man mit dem Schlagwort «Zähmung des Kapitalismus» charakterisieren. Oft ist dies jedoch eine Camouflage. Viele, die den Kapitalismus angeblich nur zivilisieren möchten, streben ein System an, das mit der Marktwirtschaft von unten, der dezentralisierten Entscheidungsfindung eines liberalen Systems, wenig zu tun hat. Manches erinnert an den Traum von einem «dritten Weg» zwischen Markt und Plan, mit dem der sympathische Reformkommunist Ota Sik einst die 68er Studenten begeisterte. Dass jene, die in den letzten Jahrzehnten unter einer vermeintlichen «neoliberalen» Dominanz gelitten haben, nun ihre Chance wittern, ist verständlich. Unbegreiflich ist dagegen, wie viele angebliche Anhänger der Marktwirtschaft den Schalmeienklängen folgen und fahrlässig in den Chor jener einstimmen, die ein Versagen des Marktes beklagen und einen «Kapitalismus mit menschlichem Antlitz» fordern, als ob der Kapitalismus per se unmenschlich wäre.
Es ist eine Binsenweisheit, dass selbst schlimmste Krisen eine positive Kehrseite haben, wenn man versucht, aus ihnen zu lernen. Voraussetzung ist, dass man die Ursachen richtig diagnostiziert. Wenn man hingegen vor lauter Vorurteilen den wesentlichen Beitrag des Staates zur Entstehung der Krise verdrängt und zugleich ein idealisiertes Konzept des Marktes entwirft, das mit der Realität nichts zu tun hat, um dieses dann abzuschiessen, landet man unweigerlich bei einer harschen Systemkritik. Ein Beispiel dafür ist das Buch «How markets fail» von John Cassidy. Der Kolumnist des Magazins «The New Yorker» konstruiert darin einen Gegensatz zwischen einer utopischen Ökonomie, die den Illusionen der Harmonie, der Stabilität und der Vorhersagbarkeit erliege, und seiner realistischen Ökonomie, einem eklektischen Sammelsurium verschiedener Theorien. Er und alle anderen, die den Kapitalismus zähmen möchten, erliegen dabei zum Teil den gleichen Illusionen, die sie monieren — nur anders interpretiert.
So reden sie, erstens, ständig von richtigen, ja «besten» Ergebnissen, die der Markt entgegen den Versprechungen nicht hervorbringe. Daher müssten staatliche Interventionen für diese Resultate sorgen. Marktwirtschafter werten dagegen das, was sich auf dem Markt aus dem Zusammenspiel der Präferenzen der Nachfrager und Anbieter ergibt, nicht. Man kann diese Ergebnisse, etwa die Einkommensverteilung, politisch beurteilen und korrigieren. Das geschieht in realen Marktwirtschaften seit je, mit negativen Auswirkungen auf den Wohlstand, die eine Mehrheit aber in Kauf zu nehmen bereit scheint. Damit verwandt ist, zweitens, die Illusion der Stabilität. Für die Österreichische Schule der Ökonomie ist, was auf Märkten passiert, ein Suchprozess, charakterisiert durch Ungleichgewichte, nicht Gleichgewichte. Dieser Prozess führt oft zum Scheitern. Fehlinvestitionen, Konkurse, schöpferische Zerstörung gehören nicht staatlich bekämpft; sie sind Teil der wirtschaftlichen Evolution. Und Rezessionen sind die notwendige Korrektur von Überinvestitionen in Boom-Phasen.
Der gröbste Irrtum der Kapitalismus-Reformer ist aber, drittens, ihr Marktverständnis. Das spontane Spiel von Angebot und Nachfrage ist eine Form der Koordination unzähliger individueller Absichten. Preise und Produkte sind Ergebnis dieses Zusammenspiels. Wenn das Ergebnis nach irgendwelchen Massstäben nicht perfekt ist, hat nicht der Markt «versagt». Er ist keine handelnde Institution. Es sind immer Menschen, die «versagen», die dumm, unvorsichtig, gierig, riskant handeln. Diese Eigenschaften sind normal verteilt; es gibt beispielsweise wenige besonders Dumme und besonders Intelligente, der Rest bewegt sich in der Mitte. Wer das versteht, wird nie die Illusion hegen, Menschen in der Politik oder in Aufsichtsgremien seien gescheiter oder moralischer als Menschen in der Wirtschaft, im Finanzsektor. Warum auch sollten sie Risiken besser erkennen oder weniger eigennützig sein?
Deshalb braucht die Welt keinen neuen Kapitalismus. Sie braucht den Realismus, dass das Paradies nicht von dieser Welt ist und wir mit vielen Unvollkommenheiten leben müssen. Sie braucht ferner Regeln, innerhalb deren Markt stattfindet; es sollten nicht mehr Regeln sein als bisher, sondern weniger, aber bessere. Gemeint sind damit zum einen Regeln, die die Erfahrungen der Krise berücksichtigen. Die viel diskutierte Verschuldungsgrenze könnte eine solche Regel sein, eine Sondersteuer für Managerlöhne dagegen kaum. Zum anderen geht es um Regeln, die versuchen, tatsächliche «Fehlsteuerungen» im Zusammenspiel der Marktteilnehmer aufzufangen, etwa das «Gefangenendilemma», das alle dazu bringt, sich mit der Herde zu bewegen, obwohl sie erkennen, dass sich diese in eine falsche Richtung bewegt. Die Welt braucht schliesslich moralische Werte wie Mass und Verantwortung. Ohne sie kann eine freie Gesellschaft nicht funktionieren, eine von oben gelenkte aber erst recht nicht. Man stelle sich vor, man wolle mit den Sarkozys und Berlusconis dieser Welt dem Wertezerfall in der Wirtschaft zu Leibe rücken.
Eine Zähmung des Kapitalismus, die dessen schöpferische und produktive Kraft bewahrt, aber die vielen Irrungen und Wirrungen, deren Menschen fähig sind, ausschaltet, ist nicht nur eine Illusion, es ist eine unmenschliche Horrorvision. Dahinter steckt letztlich die von Karl Popper so meisterhaft zerzauste Idee vom Philosophen-Staat. Die Krise hat ihr wieder mehr Auftrieb verliehen. Aber sie ist für eine offene Gesellschaft in Politik wie Wirtschaft heute genauso gefährlich — und anmassend — wie zu der Zeit, in der sie Plato entworfen hat.
Dieser Artikel wurde in der «Neuen Zürcher Zeitung» publiziert. Das Liberale Institut bedankt sich beim Autor für die freundliche Genehmigung zur Weiterveröffentlichung.
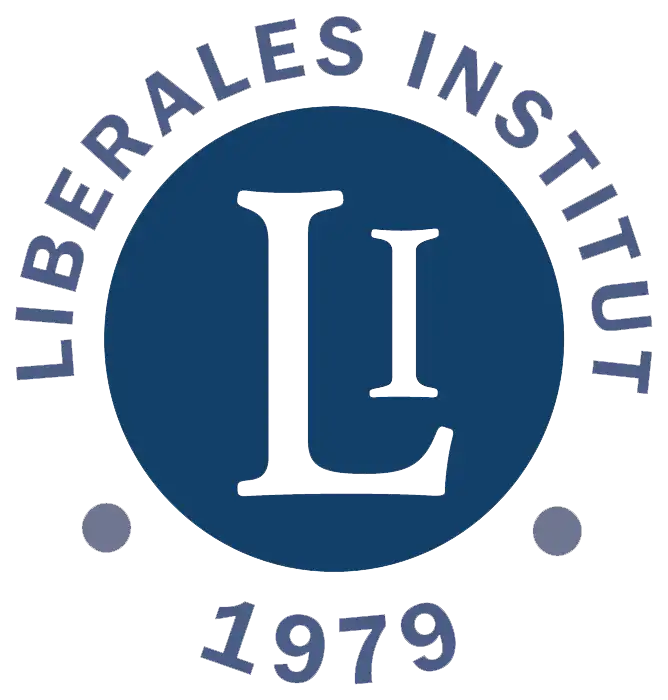
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.