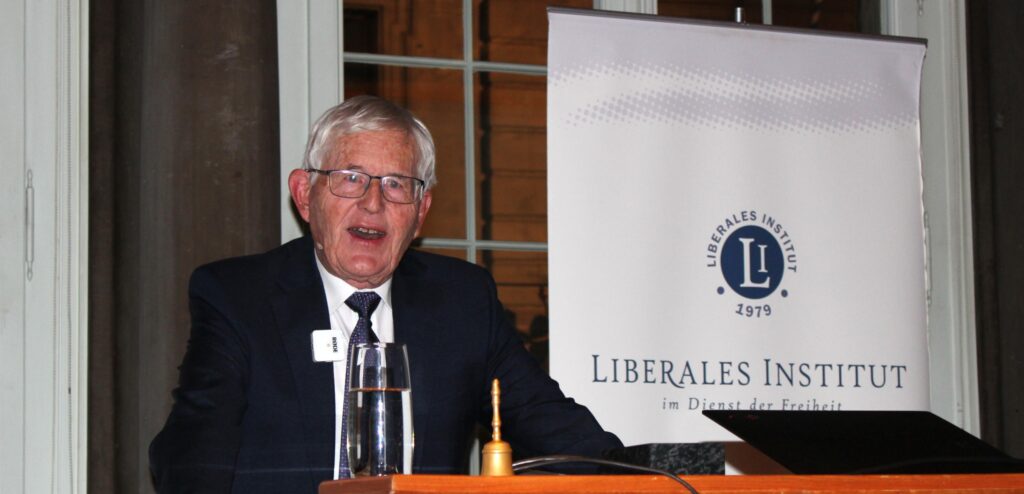
Bei diesem Text handelt es sich um die Preisträgerrede von a. Bundesrat Kaspar Villiger, die er anlässlich der Verleihung des Röpke-Preises für Zivilgesellschaft an der LI-Freiheitsfeier vom 3. Dezember im Zunfthaus zur Saffran in Zürich gehalten hat.
Zurzeit scheint Murphy’s Law die Welt zu regieren. Alles läuft schief, was schieflaufen kann. Ob in der Ukraine, im Gaza, im Sudan oder in Syrien: Überall lodern Feuer mit Eskalationspotential und mit überforderten Feuerwehren. Der künftige Führer der einzigen demokratischen Supermacht pfeift auf den Rechtsstaat, und seine wirtschafts- und sicherheitspolitischen Signale irrlichtern zwischen unberechenbar und abenteuerlich. Die beiden europäischen Führungsmächte Frankreich und Deutschland sind wirtschaftlich und politisch angeschlagen, und die UNO wirkt hilfloser denn je. Unsere auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat beruhende Gesellschaftsordnung ist durch den offensichtlichen Kollaps der unipolaren Weltordnung existentiell bedroht. Alles, wovon ich ein Leben lang gehofft habe, es werde das Leben der Menschen auf unserem Planeten freier, wohlhabender und friedlicher machen, droht zertrümmert zu werden. Die kleine weltoffene exportabhängige Schweiz steht mitten in diesem Tornado und scheint es nicht zu merken. Es geht um Freiheit. Deshalb muss uns das an einer Freiheitsfeier beschäftigen. Deshalb möchte ich heute davon sprechen. Vergessen Sie also den im Programm angegebenen Titel meines Referats! Aber vorab möchte ich für den Röpke-Preis und für die Würdigung durch Robert Nef herzlich danken. Ich weiss diese Ehrung sehr zu schätzen.
Mein Vater war ein ausgesprochen freiheitlich denkender Mann. Was er mir in meiner Jugend mitgegeben hat, lässt sich in vier Prinzipien zusammenfassen: Erstens kann sich der Mensch nur in Freiheit wirklich entfalten. Das bedeutet, dass er soll tun dürfen, was er will, und dass er nicht tun muss, was er nicht will. Zweitens: Um die Freiheit des Einen durch freiheitsbedrohendes Handeln des Andern zu schützen, braucht es den Rechtsstaat, der Regeln setzt und diese notfalls mit Gewalt durchsetzen kann. Dieser Rechtsstaat muss drittens seine Legitimation mittels Demokratie vom Volk beziehen, aber er bedarf der Kontrolle, damit er nicht zum despotischen Staat entartet und die Freiheit, die er schützen soll, wieder erstickt. Allerdings müssen die grundlegenden Freiheits- und Menschenrechte auch vor einer allfälligen Diktatur der Mehrheit geschützt werden. Viertens ist nur frei und unabhängig, wer auch über einen hinreichenden Wohlstand verfügt, und dieser kann für alle Menschen nur durch Marktwirtschaft geschaffen werden. Röpke, der Namensgeber Ihres Preises, hat ergänzt – und Ernst Fehr hat es empirisch nachgewiesen -, dass freie und auf dem Wettbewerb basierende Marktwirtschaft – ich zitiere – «von einem festen Rahmenwerk gesellschaftlich-politisch-moralischer Art gehalten und geschützt werden muss». Oder, wie man es in Anlehnung an den amerikanischen Präsidenten James Madison sagen könnte: Weil Menschen fehlbar sind, braucht es den Staat, aber weil auch der Staat fehlbar ist, braucht es Mechanismen, die seine Irrtümer aufzeigen und korrigieren, etwa Neuwahlen, unabhängige Medien, Gewaltenteilung etc.
Mein Leben als Unternehmer und Politiker hat mir die Richtigkeit dieser Prinzipien bestätigt. Der liberale demokratische Rechtsstaat ist wahrscheinlich die grösste zivilisatorische Leistung der Menschheit, weil er die Realisierung des Besten im Menschen ermöglicht und die angeborenen dunklen Seiten in uns bändigen hilft. Aber er ist ein uns nicht angeborenes künstliches und höchst verletzliches Gebilde, das unter permanentem Beschuss aggressiver Krankheitserreger steht.
Ich will nur stichwortartig einige dieser Erreger aufzählen. Weil ein minimaler Bestand an gemeinsamen Werten und Überzeugungen ein Fundament jeder Demokratie ist, kann deren Erosion den Zerfall der Demokratie einleiten. Weil die erwähnten Prinzipien immer Zielkonflikte enthalten, ist keines davon lupenrein umsetzbar. Deshalb braucht es immer ausgewogene Kompromisse, die nie alle zufriedenstellen werden. Weil in komplexen Systemen wie in einem Staat oder einer Volkswirtschaft nie alle Einflussfaktoren und deren Interaktionen hinreichend identifiziert werden können und weil auch Zufälle oft zuschlagen, haben Massnahmen häufig unerwartete und unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Dass wir alle unter kognitiven Verzerrungen leiden, die uns die Wirklichkeit oft als anders erscheinen lassen, als sie ist, kann fatale Folgen haben. Sie sind Ursache von Verschwörungstheorien, Massenhysterien, Selbstüberschätzung, Fehlbeurteilung von Wahrscheinlichkeiten und vielem anderem mehr. Weiter führt die rasante technologische Entwicklung zu ebenso rasanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, die unser Anpassungsvermögen mit handfesten politischen Folgen überfordern können. Weiter gibt es viele Menschen, die gar keine Freiheit wollen, denn Freiheit ist auch Bürde und ermöglicht immer auch die falsche Wahl. Wer aber unter der falschen Wahl scheitert, gibt kaum je sich selber die Schuld, sondern den Politikern, den Managern, den Ausländern, den Bilderbergern usw. usf. Und diejenigen, die vom Staat Betreuung statt Sicherung der Freiheit erwarten, begünstigen die Entwicklung zu einem despotischen Staat.
Weiter hat die Akzeptanz der Demokratie auch mit dem eigenen Wohlstand zu tun, den man nicht mit dem historischen Mittelwert, mit dem Stand vor hundert Jahren oder mit einem afrikanischen Staat vergleicht, sondern mit dem besserverdienenden Nachbarn. Es war F.A. von Hayek, der schrieb, das Einzige, was die Demokratie gefährden könne, sei eine lange dauernde Phase der wirtschaftlichen Stagnation oder gar Rezession. So sind denn wohl wirtschaftliche Verlustängste angesichts der mannigfachen Krisen ein wichtiger Grund für die in vielen Ländern abnehmende Zustimmung zur Demokratie.
Die Mutter aller Fehlanreize ist aber die stete Versuchung für die Parteien, das Gefällige und nicht das Notwendige zu tun, um Wahlen zu gewinnen, etwa durch Geschenke an die eigene Klientel auf Kosten anderer (meist hübsch versteckt) oder auf Kosten der durch den Demographiewandel ohnehin schon überlasteten nächsten Generationen mittels Verschuldung. Das ist letztlich die Ursache der enormen und gefährlichen Verschuldung vieler Länder. Dieser Versuchung ist bekanntlich in den Neunzigerjahren auch die Schweizer Politik erlegen. Weil damals das Volk solider als seine Politiker war, stimmte es der Schuldenbremse mit überwältigender Mehrheit zu. Es war sozusagen ein Pakt des Finanzministers mit dem Volk, um Regierung und Parlament zu finanzpolitischer Disziplin anzuhalten. Der von der Linken vorhergesagte Weltuntergang trat nicht ein. Im Gegenteil: Die Schweiz erlebte eine eindrückliche Phase der Prosperität.
Trotz aller dieser Krankheitserreger haben liberale Demokratien Erstaunliches geleistet. Sie sind wohlhabender als andere Systeme. Sie finden mit Meinungsfreiheit rascher Lösungen für neu auftauchende Probleme als Autokratien. Ihre Kinder sind besser gebildet, sie führen weniger Kriege, ihre Frauen haben gleiche Rechte, und sie haben langfristig grösseres Wirtschaftswachstum. Es ist kein Zufall, dass Flüchtlingsmassen vor ihren Toren und nicht vor den Toren Chinas, Irans oder Russlands stehen. Obwohl Demokratien wegen der inhärenten permanenten politischen Turbulenzen oft schwächer wirken als sie sind, haben sie den zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg gewonnen.
Nun aber passiert zweierlei: Erstens scheinen die Immunsysteme der Demokratien gegen die erwähnten Krankheitserreger zu schwächeln, und zweitens blasen mächtige und hochgerüstete Autokratien zum Angriff auf die Demokratien und ihre Werte.
Als noch im Zweiten Weltkrieg geborener Spross einer Unternehmerfamilie, die schon seit 1910 auch in Deutschland tätig ist, lernte ich von meinem Vater, was Krieg und Diktatur bedeuten. Als Bürger, Unternehmer und Soldat erlebte ich im Kalten Krieg den Spannungszustand des atomaren Patts und das totale Versagen der sozialistischen Planwirtschaft. Den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebte ich als eine Art Erlösung. Bei meinem Besuch der untergehenden Sowjetunion im Jahre 1989 hatte ich allerdings nach sehr beunruhigenden Gesprächen mit dem Verteidigungsminister und seinen Generälen grosse Zweifel, ob die sich abzeichnende Wende mit Glasnost oder Perestroika wirklich nachhaltig war. Heute wissen wir es. Sie war es nicht. Als dann aber neue Nationalstaaten entstanden, sich Demokratien bildeten und Marktwirtschaft sowie Globalisierung eine ungeahnte weltweite Wohlstandzunahme zu erzeugen begannen, kam auch ich zur Überzeugung, Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft, Rechtsstaat und Menschenrechte könnten sich global durchsetzen und zu einer wohlhabenderen und friedlicheren Welt führen. Dass sich jetzt dieser Trend mit grösster Brutalität umkehrt, bewegt und enttäuscht mich zutiefst.
Drei Vorstellungen, die nach dem Ende des Kalten Krieges unsere Hoffnung auf eine bessere Welt beflügelt hatten, erwiesen sich als Illusionen. Erstens führt der augenscheinliche Erfolg von Demokratie und Markwirtschaft nicht dazu, dass alle Staaten der Welt den Demokratien nacheifern wollen. Der wirtschaftliche Erfolg von Autokratien, die auf Kapitalismus und Marktwirtschaft setzen, macht diese zum Vorbild von Populisten in schwachen Demokratien. Zweitens zeigt sich, dass wirtschaftliche Macht die militärische nicht ersetzen kann. Die fatalen Folgen der Übernutzung der Friedensdividende im Westen belegt das jetzt drastisch. Drittens stimmt es nicht, dass wirtschaftliche Verflechtung immer Kriege zu verhindern vermag.
Dass wir jetzt den Zerfall einer Weltordnung erleben, ist historisch nichts Neues. Keine hat ewig überlebt. Aber niemand kann voraussagen, was jetzt auf uns zukommt. Ich kann nur versuchen zu skizzieren, in welcher Richtung sich die Dinge entwickeln könnten.
Es zeichnet sich die Bildung von drei Werteräumen mit fundamental unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen ab. Der liberal-demokratisch-rechtsstaatliche Werteraum mit Ländern wie die USA, die EU, Kanada, Australien, Japan oder Südkorea geht von gleichrangigen souveränen Nationalstaaten aus, die einerseits im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen und andererseits in friedlicher Koexistenz kooperieren.
Ein autokratisch-antidemokratischer Werteraum, dominiert von der Achse Russland-China-Iran-Nordkorea, strebt kraftvoll eine Staatenhierarchie an, in welcher wenige vollständig souveräne Mächte imperiale Vorherrschaft über Einflusszonen in ihrem Vorfeld ausüben. Russland zählt Länder wie die Ukraine, das Baltikum, Armenien, Georgien oder Moldavien zu diesem Vorfeld, für China sind es Taiwan und einige Länder der sogenannten «Belt and Road»-Initiative. Diese Achse hat das klare Ziel, die von ihnen beanspruchten Räume zu dominieren und eine durch die westlichen demokratischen Werte dominierte Weltordnung zu verhindern, notfalls mit Waffengewalt. Sie ist auch aktiv daran, die internationalen Organisationen einschliesslich der UNO systematisch auf ihre Wertvorstellungen umzutrimmen. Darüber kann auch das dürftige G-20 Abschlusscommuniqué nicht hinwegtäuschen.
Den dritten Raum bildet eine chaotisch-vielfältige bunte Staatengruppe mit defekten Demokratien und sogenannten Fassadendemokratien (die nur auf manipulierten Wahlen beruhen), die sich nicht eindeutig festlegen, die aber dem westlichen Wertesystem kritisch gegenüberstehen. Der autokratische Club versucht diese Gruppe einzubinden, beispielsweise über das BRICS-Gebilde, und dies – wie das BRICS-Treffen vom Oktober in Tatarstan zeigt – mit einigem Erfolg. Weil diese Gruppe zusammen mit der Autokratenachse die rasch wachsende Mehrheit der Weltbevölkerung ausmacht, ist eine Marginalisierung der Demokratien nicht mehr auszuschliessen.
Den Demokratien stellt sich die Frage des Umgangs mit dieser Konstellation. Weil nicht nur der Autokratieklub, sondern auch die bunte Zwischengruppe das Aufdrängen der westliche Werte als Einmischung in die inneren Angelegenheiten ablehnt, wird der Demokratieklub diese Missionstätigkeit notgedrungen zurückfahren müssen. Er hat die Kraft dafür nicht mehr und er hat wegen eigener interner Probleme an Vorbildwirkung eingebüsst. Er wird sich auf viererlei konzentrieren müssen: Durch Lösung seiner internen Probleme die Stabilität und Vorbildwirkung zurückzugewinnen, den machtpolitisch bedrohten Demokratien (Ukraine, Taiwan, Israel) beim Überleben zu helfen, die potentiell demokratiefähigen Staaten der Mittelgruppe zu unterstützen, um ihr gänzliches Abgleiten in die Autokratie zu verhindern, sowie die Selbstbehauptung durch militärische Abschreckung zu sichern. Notgedrungen wird «democracy protection» die «democracy promotion» ablösen müssen.
Gleichzeitig müssten sich die beiden Hauptblöcke auf minimale, aber hinreichend durchsetzbare Regeln des Zusammenlebens einigen. Das dürfte nicht ganz unmöglich sein: Einerseits gibt es Schnittmengen der Interessen in Bereichen, deren Probleme nur gemeinsam lösbar sind, etwa die globale Erwärmung, die Bekämpfung von Pandemien oder die Massenmigration. Andererseits geht es um die Vermeidung von Konflikten mit einem Eskalationspotential bis zur Zerstörung des menschlichen Lebens auf dem Planeten. Das Treffen unlängst von Biden mit Xi Jinping ist ein zaghaftes Signal in dieser Richtung.
Alles das wird Arbeit uns Kraft, aber auch Leidensvermögen brauchen. Ob der wohlstandsverwöhnte Westen das schafft, ist zurzeit offen.
In diesem turbulenten Umfeld steht die Schweiz sozusagen als Insel der Seligen da. Gemessen an fast allen Kriterien des Erfolgs eines Staates, etwa Wohlstand, Stabilität, demokratische Legitimation, Standortqualität, soziale Ausgeglichenheit, Lebenserwartung oder Lebensqualität, steht sie in einer Spitzengruppe. Das hat sie – neben glücklichen Umständen – einer politischen Kultur zu verdanken, die auf geglückte Weise zwei komplementäre Prinzipien vereinigt: Das Freiheitsprinzip mit seinen Freiheitsrechten und seiner noch einigermassen freiheitlichen Wirtschaftsordnung einerseits und das Genossenschaftsprinzip andererseits, das mit seinen gemeinschaftsorientierten Werten unser soziales Zusammenleben begünstigt. Haarrisse in dieser erfolgreichen Kultur sind indessen unübersehbar. Mir scheint, die Schweiz sei seit dem Weltkrieg nie mehr vor einer derartigen Massierung von Herausforderungen gestanden, aber Politik und Gesellschaft seien sich dessen mehrheitlich kaum bewusst und lebten in einer selbstgefälligen Traumwelt.
Die Herausforderungen, vor denen die Schweiz steht, lassen sich in drei Kategorien einteilen: Erstens die äusseren Herausforderungen, die wir nicht beeinflussen können: Dazu gehören etwa Erschwerungen im Aussenhandel durch Rückschläge im Globalisierungsprozess, die erhöhte Gefahr hybrider und heisser Kriege, die gigantische globale Verschuldung mit ihren unterschätzten Risiken, die Mindeststeuerproblematik oder die globale Erwärmung. Dazu kommen zweitens innere Herausforderungen, die kaum beeinflussbar sind, etwa die Demografie, die uns viel heftiger treffen wird, als viele denken, das hohe Kostenniveau, der Druck des Wechselkurses oder die winzigen Dimensionen unseres Binnenmarktes. Drittens aber stehen wir vor schwierigen innenpolitischen Problemen, die theoretisch lösbar wären, aber durch politische Blockaden mit gefährlichen Folgen unlösbar zu werden drohen. Ich denke an den Reformstau in wichtigen Bereichen wie die Sicherung des Zugangs zum EU-Binnenmarkt, die Kompromissresistenz durch zunehmende Polarisierung, die Verschlammung des Erfolgsfaktors Föderalismus oder die wachsende Skepsis einer hervorragend funktionierenden Wirtschaft gegenüber.
Was Not täte, ist die Auflösung des erwähnten Reformstaus durch eine Revitalisierung unserer Kompromisskultur, die Verbesserung statt der permanenten Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um angesichts des schwierigeren Umfelds konkurrenzfähig zu bleiben, die Erhaltung der finanziellen Resilienz des Systems Schweiz, die nachhaltige Konsolidierung der Altersvorsorge sowie die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit des Landes. Ob das in der gegenwärtigen polarisierten und gehässigen Politiklandschaft möglich ist, in welcher Fakten hemmungslos bis zum Überschwappen in die Lüge zugespitzt werden, ist offen.
Glückliche Zufälle haben mich in den Bundesrat gehievt und mir im Leben immer wieder grosse Verantwortung überbunden. Obwohl Verantwortung immer auch Bürde ist, habe ich das als Privileg empfunden. Trotz Gefühlsschwankungen, die auch mir nicht erspart geblieben sind, ging ich fast tagtäglich mit Freude ans Werk. Das erfüllt mich noch heute mit Dankbarkeit. Work ist eben nicht ein Gegensatz zu Life, wie die abwegige Diskussion über die Work-Life-Balance suggeriert, sondern notwendiger und erfüllender Teil des Life. Dabei habe ich immer versucht, im zähen Brei der widrigen Umstände gemäss den erwähnten vier Prinzipien zu handeln. Ob es um die Aufarbeitung der Fichen im Militär, die dringliche Beschaffung eines tauglichen Kampfflugzeugs, die Behebung des administrativen Chaos in der Bundespensionskasse, die Sanierung der Bundesfinanzen mittels Schuldenbremse, die Erneuerung des Föderalismus, die Erhaltung der Infrastruktur für den Zugang des Luftverkehrs zu den globalen Wirtschaftszentren oder schliesslich gar um die Mitarbeit an der Stabilisierung einer taumelnden Grossbank ging: Immer zeigte sich, dass zwischen der Verkündung hehrer Prinzipien in Sonntagreden und der zur Lösung konkreter Probleme notwendigen harten Knochenarbeit im permanenten Gegenwind ein enormer Unterschied besteht. Mühsam war’s immer, und nie ging es der wegen der Notwenigkeit der Mehrheitsfähigkeit ohne Kompromisse, die auch notgedrungen immer wieder die Prinzipien ritzten. Aber immer durfte ich – und dafür bin ich noch heute dankbar – auf hervorragende Teams zählen, ohne die das alles nicht hätte bewältigt werden können.
Zu meiner Freude sind mit meiner Familie auch meine beiden Enkelinnen heute anwesend. Deshalb hat sich mir plötzlich die Frage gestellt, wie junge Leute am Anfang ihrer höheren Ausbildung sich fühlen müssen, wenn ihr Grossvater derart düstere Zukunftsszenarien entwirft. Und so Gemeinplätze wie «Krisen sind immer auch Chancen» oder «so schlimm wird’s ja wohl auch nicht werden» helfen auch nicht weiter. Ich halte die Lage wirklich für ernst. Aber ist sie auch aussichtslos?
Die Geschichte ist nicht vorhersehbar. Immer gibt es auch unerwartete positive Umbrüche, wie 1989 der Fall der Mauer. Menschen haben die Gabe, unter freiheitlichen Bedingungen Ungeahntes zu leisten. Die Aufklärung hat mit Gedankenfreiheit, Vernunft, Wissenschaft und Humanismus Kräfte deblockiert, die die Mehrheit der Menschheit in historisch kurzer Zeit von den Fesseln jahrtausendelanger unvorstellbarer Armut befreite. In Deutschland haben mutige Männer unter Inkaufnahme der Abwahl mehrmals fundamentale Krisen überwunden, etwa Ludwig Erhard, der mit einem verwegenen Liberalisierungsprogramm das Wirtschaftswunder erzeugte, oder Gerhard Schröder, dessen Agenda 2010 aus dem kranken Mann Europas wieder eine blühende Volkswirtschaft machte. Sollte es einer Regierung Merz gelingen, mittels Entfesselung marktwirtschaftlicher Kräfte die durch Bürokratie und subventionsverheissende Einlullung entstandene Lähmung Deutschlands zu überwinden, würde sich der Kollaps der Ampel als Segen erweisen. Als Chairman einer Ländergruppe im Währungsfonds konnte ich hautnah miterleben, wie Vize-Ministerpräsident Leszek Balcerowicz durch ein radikales Liberalisierungsprogramm aus dem mausarmen rückständigen Polen ein sehr erfolgreiches Schwellenland machte, das erst kürzlich eine zwischendurch pfuschende populistische Regierung wieder abwählte. Was Mut und Weitsicht bewirken kann, haben in unserem Land in den Dreissigerjahren der Gewerkschafter Konrad Ilg und der Arbeitgeber Ernst Dübi bewiesen, die nach wohlstandsgefährdenden erbitterten Arbeitskämpfen im Juli 1937 das sogenannte Friedensabkommen der Metall- und Uhrenindustrie abschlossen, das zur Grundlage der für die Schweiz so segensreichen Sozialpartnerschaft wurde.
Aber auch die Überwindung der Flaute der späten Neunzigerjahre durch die Schweiz ist interessant. Es war nicht die Ablehnung des EWR, welche die Wende brachte, wie in Herrliberg immer behauptet wird. Im Gegenteil. Indirekt haben wir dem EWR viel zu verdanken. Einer Idee von Prof. Heinz Hauser von der Uni St. Gallen folgend setzten Bundesrat und Parlament in einem Kraftakt jene Liberalisierungsschritte autonom um, die uns vom EWR aufgezwungen worden wären und die wir ohne Vorbereitung auf den EWR niemals geschafft hätten, und wir konnten in einem mehr als mühsamen Prozess diese Reformen mit den sattsam bekannten Bilateralen erweitern. Das und die Schuldenbremse erwiesen sich als Motoren, so dass statt der von der Linken wegen der Schuldenbremse vorausgesagten wirtschaftlichen Katastrophe die erwähnte beispiellose Phase der Prosperität folgte.
Die USA, die den Europäern punkto Wachstum und Zunahme der Produktivität meilenweit vorauseilen, werden noch für Jahrzehnte von China nicht eingeholt werden können, dessen Bevölkerung zu schrumpfen beginnt und das nicht zuletzt dank kommunistischer Re-Ideologisierung vor enormen strukturellen Problemen steht. Von den strukturellen Trümmern, die Putin in seinem Land hinterlässt, will ich gar nicht reden. Wir dürfen deshalb die Kraft der autokratischen Achse auch nicht überschätzen. Obwohl der völlig unberechenbare neue Präsident der USA mit Lügen, Drohungen und Verdrehungen nur so um sich schmeisst, was – sollte er das alles durchsetzen – Schlimmstes befürchten lässt, darf man den Willen der Amerikaner zur Freiheit, die Kraft der Checks und Balances sowie die Begrenzung der Macht des Präsidenten durch die Kompetenzen der Gliedstaaten nicht unterschätzen. Und ein unberechenbarer Präsident mag immer wieder auch Treffer landen. Vielleicht wäre da plötzlich sogar ein Freihandelsvertrag der Schweiz mit den USA denkbar, allerdings nur, wenn es nicht wieder an kleinkariertem helvetischem Herummäkeln scheiterte.
Es kann also auch heute nicht ausgeschlossen werden, dass Murphy’s Law wieder einmal ausser Kraft tritt. Gerade die Schweiz hat nicht die schlechtesten Karten, wenn sie sich auf ihre Stärken besinnt. Sie hat eine Superwirtschaft, hervorragende Universitäten, ein tolles duales Bildungssystem, dank Schuldenbremse eine solide finanzielle Basis, eine ausgezeichnet arbeitende unabhängige Notenbank, ein wohl noch immer mehrheitlich solides und fleissiges Volk. Und noch etwas ist wichtig: Die parteipolitische Zersplitterung moderner Gesellschaften führt in parlamentarischen Demokratien zunehmend zu komplizierten Koalitions- oder Minderheitsregierungen, oft mit dem Ergebnis von Chaos oder Stagnation. Unsere direkte Demokratie mit der Dauerkoalition in der Regierung, mit je nach Sachvorlage wechselnden Mehrheiten im Parlament, ohne zwingende Fraktionsdisziplin und mit dem Volk als Schiedsrichter bei wichtigen Sachentscheiden erlaubt uns ein letztlich achtbares Durchwursteln durch zersplitterte politische Landschaften. Unsere Chancen, auch schwierige Herausforderungen zu stemmen, stehen gut. Aber ohne Leistung und Arbeit wird es nicht gehen, auch nicht ohne die Revitalisierung des liberalen Erbes und unserer Kompromissfähigkeit. Das bräuchte es jetzt: Eine Schweiz, die erwacht und die sich an einen Runden Tisch setzt, um die vorhandenen Ressourcen mit den Herausforderungen des Landes in Einklang zu bringen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich auch im heutigen Politbetrieb in allen Lagern Persönlichkeiten finden, die das anzupacken vermöchten.
Sie verleihen mir heute den Röpke-Preis. Für mich als Ingenieur
war Röpkes «Jenseits von Angebot und Nachfrage» eines der ersten ökonomischen Bücher, die mich begeisterten. Seine Verbindung von ökonomischer marktbasierter Effizienz mit ethischen und sozialen Werten und seine Gedanken zur ordnenden Rolle des Staates überzeugten mich. Wenn man mich in ein Kästchen einordnen wollte, wäre ich wohl eine Art Ordo-Liberaler. Sie haben mich für würdig befunden, mir Ihren Röpke-Preis zu verleihen. Ich habe nicht zu beurteilen, ob ich diesen Preis wirklich verdiene. Ich darf mich einfach darüber sehr freuen, und das tue ich. Nehmen Sie meinen herzlichen Dank!
a. Bundesrat Kaspar Villiger
Tags:

LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.