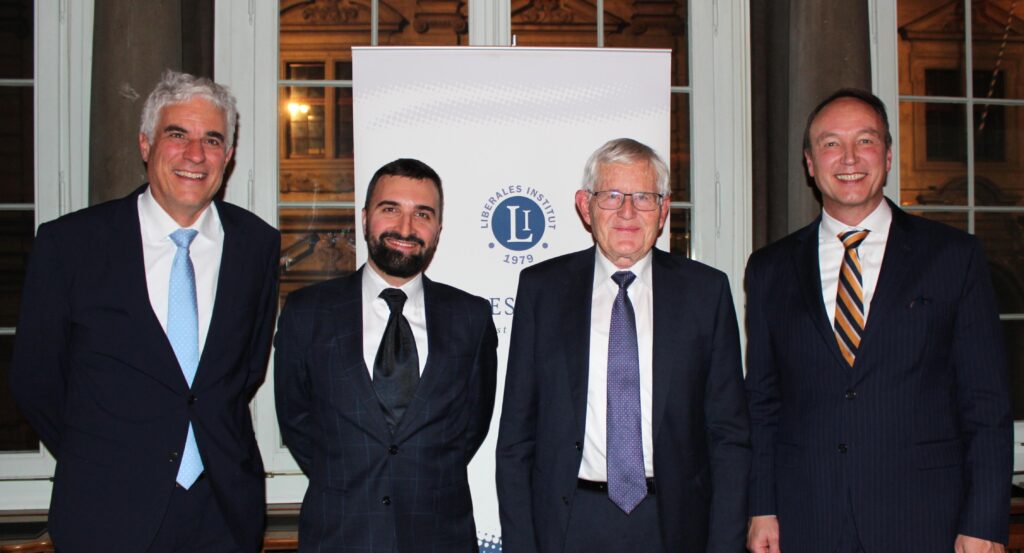
«Freiheit» wird von immer mehr Menschen als ein Anspruch interpretiert. Ein Anspruch darauf, dass die Anstrengungen für den eigenen Lebensunterhalt von anderen übernommen werden. Man ist überzeugt, ein Recht auf staatlich zur Verfügung gestellte Güter und Dienstleistungen zu haben und auf eine ganzheitliche Umsorgung in allen Lebensbereichen. Sei es im Bereich der Altersvorsorge, der Gesundheit, der sozialen Sicherheit, der Bildung, der Medien, der Landwirtschaft, der Kultur, der Infrastruktur, des Verkehrs, der Kinderbetreuung und in vielen weiteren Bereichen: Überall soll es der Staat richten.
Was macht diese Abwälzung, dieses Outsourcing der persönlichen Verantwortung mit dem Einzelnen? Welche gesellschaftlichen Entwicklungen werden dadurch angestossen? Ist eine staatlich dominierte Form des Zusammenlebens mittel- bis langfristig überhaupt kompatibel mit Frieden, Wohlstand und Menschenwürde? Oder leiten wir mit dem Übergang vom Minimal- zum Maximalstaat unvermeidbar unseren Niedergang ein? Wie kommen wir von der fragilen Forderungsgesellschaft zurück zu einer robusten Selbstverantwortungsgesellschaft und welche geeigneten Mittel stehen uns dafür zur Verfügung? Mit diesen Fragen befassten sich die 150 Teilnehmer der LI-Freiheitsfeier vom 3. Dezember 2024 im Zunfthaus zur Saffran in Zürich.
 In seiner Einführung gab LI-Direktor Olivier Kessler zu bedenken, dass bei zunehmender staatlicher Zuständigkeit in immer mehr Lebensbereichen Lobbyismus, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch grösser würden. Wenn der Staat nicht mehr nur für freiheitliche Rahmenbedingungen sorge, sondern ein grosser Teil der Früchte der Arbeit der Bürger einsammle und es anstelle der Bürger ausgebe, würden sich immer mehr Interessengruppen professionell um diesen Geldtopf herum organisieren. Je grösser dieser staatliche Geldtopf werde, desto lukrativer erschienen Versuche der Einflussnahme auf die Mittelverteilung und Gesetzgebung. Staatliche Regeln und Befehle verkämen dann immer mehr zu einem Durchsetzungsinstrument von Partikularinteressen, anstatt dass damit das Allgemeinwohl gefördert werde.
In seiner Einführung gab LI-Direktor Olivier Kessler zu bedenken, dass bei zunehmender staatlicher Zuständigkeit in immer mehr Lebensbereichen Lobbyismus, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch grösser würden. Wenn der Staat nicht mehr nur für freiheitliche Rahmenbedingungen sorge, sondern ein grosser Teil der Früchte der Arbeit der Bürger einsammle und es anstelle der Bürger ausgebe, würden sich immer mehr Interessengruppen professionell um diesen Geldtopf herum organisieren. Je grösser dieser staatliche Geldtopf werde, desto lukrativer erschienen Versuche der Einflussnahme auf die Mittelverteilung und Gesetzgebung. Staatliche Regeln und Befehle verkämen dann immer mehr zu einem Durchsetzungsinstrument von Partikularinteressen, anstatt dass damit das Allgemeinwohl gefördert werde.
 In seinem Gastreferat verglich Prof. Dr. Jörg-Guido Hülsmann, Professor an der Fakultät für Recht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Angers und Mitglied im Akademischen Beirat des Liberalen Instituts, das Staatswachstum mit dem Wachstum von Pflanzen: Beide wucherten und beide müsse man gelegentlich zurückstutzen. Für die Aufblähung des Staates gebe es vier Gründe: Erstens, die Eigeninteressen der Akteure im Staat, die nach mehr Macht, Einfluss, Kontrolle und höheren Löhnen strebten. Zweitens, die Einflussnahme privater Interessengruppen (z.B. mittels Lobbying), um möglichst viele staatliche Mittel z.B. in Form von Subventionen für sich selbst zu ergattern. Drittens, die Interventionsspirale: Jede staatliche Intervention führe dazu, dass unbedachte Nebeneffekte auftreten und zu weiteren Interventionen führten. Viertens, der Abfall vom Glauben: Gläubige hätten ein Grundvertrauen in Gott und die Welt, während Ungläubige immer in Angst lebten und sich vor allen möglichen Dingen, die schieflaufen könnten, fürchteten. Folglich werde der Staat als Gottersatz damit beauftragt, uns davor zu schützen und alles feinzuregeln. Staatsabbau sei nicht nur das Gebot der Stunde, sondern ein Gebot jeder Stunde. Man müsse jede sich bietende Gelegenheit ergreifen, den Staat zurückzustutzen.
In seinem Gastreferat verglich Prof. Dr. Jörg-Guido Hülsmann, Professor an der Fakultät für Recht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Angers und Mitglied im Akademischen Beirat des Liberalen Instituts, das Staatswachstum mit dem Wachstum von Pflanzen: Beide wucherten und beide müsse man gelegentlich zurückstutzen. Für die Aufblähung des Staates gebe es vier Gründe: Erstens, die Eigeninteressen der Akteure im Staat, die nach mehr Macht, Einfluss, Kontrolle und höheren Löhnen strebten. Zweitens, die Einflussnahme privater Interessengruppen (z.B. mittels Lobbying), um möglichst viele staatliche Mittel z.B. in Form von Subventionen für sich selbst zu ergattern. Drittens, die Interventionsspirale: Jede staatliche Intervention führe dazu, dass unbedachte Nebeneffekte auftreten und zu weiteren Interventionen führten. Viertens, der Abfall vom Glauben: Gläubige hätten ein Grundvertrauen in Gott und die Welt, während Ungläubige immer in Angst lebten und sich vor allen möglichen Dingen, die schieflaufen könnten, fürchteten. Folglich werde der Staat als Gottersatz damit beauftragt, uns davor zu schützen und alles feinzuregeln. Staatsabbau sei nicht nur das Gebot der Stunde, sondern ein Gebot jeder Stunde. Man müsse jede sich bietende Gelegenheit ergreifen, den Staat zurückzustutzen.
____
 Im zweiten Teil des Abends fand die Verleihung des Röpke-Preises für Zivilgesellschaft statt. Das Liberale Institut verlieh den Preis bereits zum 15. Mal. Die Idee hinter dem Preis hat natürlich mit Wilhelm Röpke zu tun, einem Ökonomen von besonderer Bedeutung für Europa aber auch für die Schweiz. Röpke lehrte 30 Jahre lang in Genf und übte durch seine regelmässigen Kolumnen unter anderem in der NZZ und auch durch seine zahlreichen Buchpublikationen einen wesentlichen Einfluss auf die öffentliche Meinung in der Schweiz aus. Mit dem Preis zeichnet das Liberale Institut jeweils eine Leistung und eine Haltung aus, die mit den Anliegen sowohl des grossen Ökonomen als auch des Instituts übereinstimmen.
Im zweiten Teil des Abends fand die Verleihung des Röpke-Preises für Zivilgesellschaft statt. Das Liberale Institut verlieh den Preis bereits zum 15. Mal. Die Idee hinter dem Preis hat natürlich mit Wilhelm Röpke zu tun, einem Ökonomen von besonderer Bedeutung für Europa aber auch für die Schweiz. Röpke lehrte 30 Jahre lang in Genf und übte durch seine regelmässigen Kolumnen unter anderem in der NZZ und auch durch seine zahlreichen Buchpublikationen einen wesentlichen Einfluss auf die öffentliche Meinung in der Schweiz aus. Mit dem Preis zeichnet das Liberale Institut jeweils eine Leistung und eine Haltung aus, die mit den Anliegen sowohl des grossen Ökonomen als auch des Instituts übereinstimmen.
 Das Liberale Institut verlieh den diesjährigen Röpke-Preis für Zivilgesellschaft an a. Bundesrat Kaspar Villiger für seinen wertvollen Einsatz zugunsten einer staatlichen Schuldenbremse. Kaspar Villiger war Unternehmer und wurde 1983 in den Nationalrat gewählt, wechselte 1987 in den Ständerat und wurde 1989 Bundesrat, ein Amt das er bis 2003 bekleidete. Der Bund hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr ausgegeben: Inflationsbereinigt sind es heute pro Kopf rund 1500 Franken oder ein Fünftel mehr als noch vor 20 Jahren. Die Schuldenbremse ist deshalb nötiger denn je. Es gilt, die Staatsdefizite durch eine Ausgabenreduktion in den Griff zu bekommen – und nicht durch eine unethische Erhöhung von Steuern und Schulden auf Kosten künftiger Generationen. Hier hat Kaspar Villiger Weitsicht bewiesen und die heutigen Forderungen an die Adresse des Staates vorausgesehen. Dazu möchten wir ihm herzlich gratulieren.
Das Liberale Institut verlieh den diesjährigen Röpke-Preis für Zivilgesellschaft an a. Bundesrat Kaspar Villiger für seinen wertvollen Einsatz zugunsten einer staatlichen Schuldenbremse. Kaspar Villiger war Unternehmer und wurde 1983 in den Nationalrat gewählt, wechselte 1987 in den Ständerat und wurde 1989 Bundesrat, ein Amt das er bis 2003 bekleidete. Der Bund hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr ausgegeben: Inflationsbereinigt sind es heute pro Kopf rund 1500 Franken oder ein Fünftel mehr als noch vor 20 Jahren. Die Schuldenbremse ist deshalb nötiger denn je. Es gilt, die Staatsdefizite durch eine Ausgabenreduktion in den Griff zu bekommen – und nicht durch eine unethische Erhöhung von Steuern und Schulden auf Kosten künftiger Generationen. Hier hat Kaspar Villiger Weitsicht bewiesen und die heutigen Forderungen an die Adresse des Staates vorausgesehen. Dazu möchten wir ihm herzlich gratulieren.
 Die Laudatio wurde von Stiftungsrat Robert Nef gehalten, der auf ein wichtiges Zitat von Röpke verwies:
Die Laudatio wurde von Stiftungsrat Robert Nef gehalten, der auf ein wichtiges Zitat von Röpke verwies:
«Wenn der Liberalismus die Demokratie fordert, so nur unter der Voraussetzung, dass sie mit Begrenzungen und Sicherungen ausgestattet wird, die dafür sorgen, dass der Liberalismus nicht von der Demokratie verschlungen wird.»
Eine dieser Sicherungen sei die mit grossem demokratischem Mehr vor 21 Jahren beschlossene Schuldenbremse gewesen, die von Kaspar Villiger lanciert und realisiert worden sei. Sie habe bis heute überlebt und stehe momentan von verschiedenen Seiten unter teils grobem Beschuss. Gute Politik stelle sich gegen den Trend, und einer der verderblichsten Trends sei die Ausgabenpolitik zulasten künftiger Generationen. Die Schuldenbremse sei ein entscheidender, wichtiger aber nicht hinreichender Schritt. Er schütze vor allem die kommenden Generationen vor einer schrittweisen Enteignung, gegen die sie sich mit demokratischen Mitteln rückwirkend nicht mehr wehren könnten. Aus liberaler Sicht brauche es aber nicht nur die Schuldenbremse, sondern die Bremse des generellen Staatswachstums.
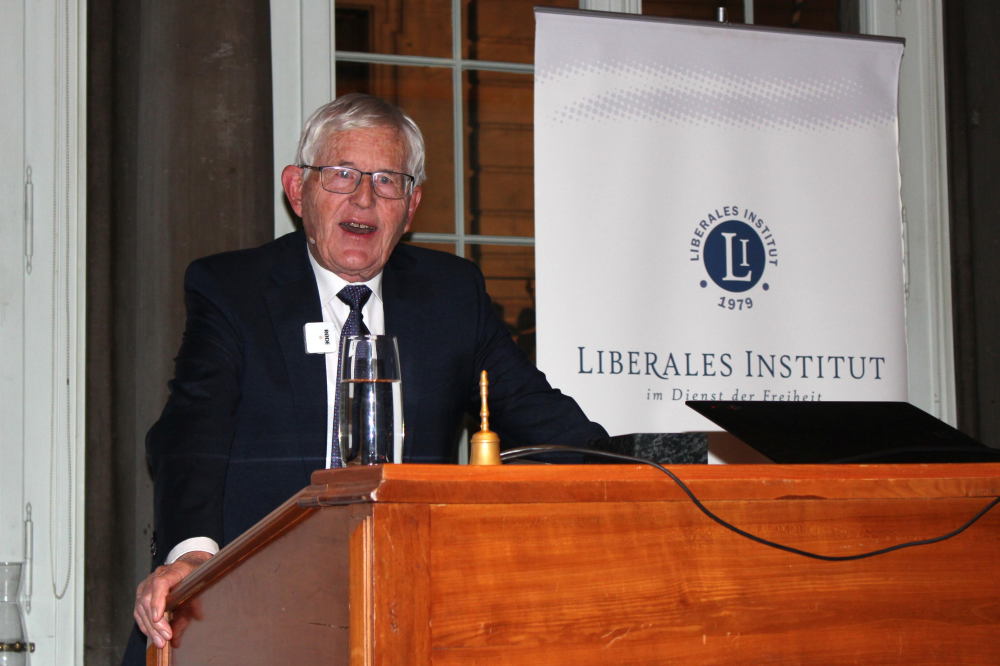 In seiner Preisträger-Rede (die es hier vollständig nachzulesen gibt) betonte Kaspar Villiger den Wert des liberal-demokratischen Rechtsstaats. Dieser sei wahrscheinlich die grösste zivilisatorische Leistung der Menschheit, weil er die Realisierung des Besten im Menschen ermögliche und die angeborenen dunklen Seiten in uns zu bändigen helfe. Aber er sei ein uns nicht angeborenes künstliches und höchst verletzliches Gebilde, das unter permanentem Beschuss aggressiver Krankheitserreger stehe. Kaspar Villiger nannte einige dieser Erreger: Beispielsweise die Erosion gemeinsamer Werte, wirtschaftliche Stagnation und die stete Versuchung für die Parteien, das Gefällige und nicht das Notwendige zu tun, um Wahlen zu gewinnen. Doch die Immunsysteme der Demokratien gegen die erwähnten Krankheitserreger würden schwächeln. Mächtige und hochgerüstete Autokratien würden ausserdem zum Angriff auf die Demokratien und ihre Werte blasen. Villiger warnte vor dem raschen Zerfall der unipolaren Weltordnung, die Gefahr der Marginalisierung von Freiheit und Demokratie im turbulenten Umfeld und die hierzulande unterschätzten Herausforderungen der Schweiz in diesem Sturm.
In seiner Preisträger-Rede (die es hier vollständig nachzulesen gibt) betonte Kaspar Villiger den Wert des liberal-demokratischen Rechtsstaats. Dieser sei wahrscheinlich die grösste zivilisatorische Leistung der Menschheit, weil er die Realisierung des Besten im Menschen ermögliche und die angeborenen dunklen Seiten in uns zu bändigen helfe. Aber er sei ein uns nicht angeborenes künstliches und höchst verletzliches Gebilde, das unter permanentem Beschuss aggressiver Krankheitserreger stehe. Kaspar Villiger nannte einige dieser Erreger: Beispielsweise die Erosion gemeinsamer Werte, wirtschaftliche Stagnation und die stete Versuchung für die Parteien, das Gefällige und nicht das Notwendige zu tun, um Wahlen zu gewinnen. Doch die Immunsysteme der Demokratien gegen die erwähnten Krankheitserreger würden schwächeln. Mächtige und hochgerüstete Autokratien würden ausserdem zum Angriff auf die Demokratien und ihre Werte blasen. Villiger warnte vor dem raschen Zerfall der unipolaren Weltordnung, die Gefahr der Marginalisierung von Freiheit und Demokratie im turbulenten Umfeld und die hierzulande unterschätzten Herausforderungen der Schweiz in diesem Sturm.
 Die diesjährige LI-Freiheitsfeier bot Anhängern aller liberaler Stossrichtungen reichlich Denkanstösse und Diskussionsstoff. Dies kam auch beim anschliessenden Apéro zum Ausdruck, wo die Themen bei guter Stimmung und Wohlwollen für die jeweils anderen Positionen eingängig weiterbesprochen wurden. Der wichtige Wettbewerb der Ideen wurde beim Liberalen Institut ein weiteres Mal gefördert und gelebt, was die Teilnehmer angesichts der zunehmend einengenden Cancel Culture zu schätzen wussten. Von diesem wichtigen liberalen Prinzip der Meinungsäusserungsfreiheit wird das Liberale Institut auch in Zukunft nicht abweichen.
Die diesjährige LI-Freiheitsfeier bot Anhängern aller liberaler Stossrichtungen reichlich Denkanstösse und Diskussionsstoff. Dies kam auch beim anschliessenden Apéro zum Ausdruck, wo die Themen bei guter Stimmung und Wohlwollen für die jeweils anderen Positionen eingängig weiterbesprochen wurden. Der wichtige Wettbewerb der Ideen wurde beim Liberalen Institut ein weiteres Mal gefördert und gelebt, was die Teilnehmer angesichts der zunehmend einengenden Cancel Culture zu schätzen wussten. Von diesem wichtigen liberalen Prinzip der Meinungsäusserungsfreiheit wird das Liberale Institut auch in Zukunft nicht abweichen.
Tags:

LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.