Über das Institut

Das 1979 gegründete Liberale Institut verfolgt das Ziel der Erforschung freiheitlicher Ideen. Das Institut untersucht die Schweizer Tradition und Kultur von individueller Freiheit, Frieden und Offenheit und setzt sich für die Weiterentwicklung der liberalen Geistestradition ein. Privatautonomie auf der Basis von Eigentum und Vertrag sowie der freie Austausch von Ideen und materiellen Gütern auf offenen Märkten in einer dezentralen Ordnung stehen dabei im Mittelpunkt.
Das Liberale Institut ist der erste unabhängige Think Tank der Schweiz. Eidgenössisch im Geiste und international in der Ausstrahlung, arbeitet es in vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Im Zentrum der Aktivitäten stehen neben vielfältigen Buchpublikationen und Online-Veröffentlichungen eine Reihe öffentlicher und privater Veranstaltungen. Das Institut betreut gezielte Programme für Nachwuchstalente aus Politik, Wissenschaft, Journalismus und Wirtschaft wie etwa die jährlich stattfindende Liberty Summer School. Dabei kooperiert es schweizweit und international mit zielverwandten Organisationen und veröffentlicht zahlreiche wissenschaftliche Indexe, z.B. der Index wirtschaftlicher Freiheit und der Index der Eigentumsrechte.
Das Liberale Institut verleiht ausserdem jedes Jahr den Röpke-Preis für Zivilgesellschaft an Persönlichkeiten, die sich für die freiheitliche Kultur der Schweiz einsetzen. Am Zürcher Standort unterhält das Institut eine Bibliothek der Freiheit, die Studierenden, Forschenden und weiteren interessierten Personen zur Verfügung steht.
Die freiheitliche Denkfabrik betreibt ausserdem die Websiten der beiden einflussreichen liberalen Ökonomen Roland Baader (1940-2012) und Anthony de Jasay (1925-2019).
Auszeichnungen
- Netzwerkpreis der Friedrich August von Hayek Gesellschaft (2021)
- Templeton Freedom Award der Atlas Economic Research Foundation (2005)
- Freiheitspreis der Max-Schmidheiny-Stiftung (1991)
Organisation
Das Liberale Institut wird getragen durch ein Team engagierter liberaler Persönlichkeiten.
Institutsleitung
Assoziierte Forscher
Assoziierte Mitarbeiter
Stiftungsrat

Daniel Eisele
Rechtsanwalt,
Zürich (Präsident)

Sandro Piffaretti
Unternehmer,
Cham (Vizepräsident)

Victoria Curzon Price
Professorin für politische Ökonomie, Genf

Michael Esfeld
Professor für Wissenschaftsphilosophie, Lausanne

Beat Gygi
Publizist,
Zürich

Daniel Model
Industrieller,
Weinfelden

Robert Nef
Publizist,
St. Gallen

Henrique Schneider
Ökonom,
Appenzell
Akademischer Beirat

Philipp Bagus
Professor für Ökonomie, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

David Dürr
Professor für Rechtswissenschaften, Universität Zürich

Richard Ebeling
Professor für Ökonomie,
The Citadel, Charleston

Florian Follert
Professor für Betriebswirtschaftslehre, Privatuniversität Schloss Seeburg, Seekirchen am Wallersee

Christian Hoffmann
Professor
für Ökonomie,
Universität Leipzig

Jesús Huerta de Soto
Professor für politische Ökonomie, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

Guido Hülsmann
Professor
für Ökonomie,
Université d’Angers

Karl-Friedrich Israel
Assistenzprofessor für Volkswirtschaftslehre, Université Catholique de l'Ouest, Angers

Stefan Kooths
Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Institut für Weltwirtschaft, Kiel
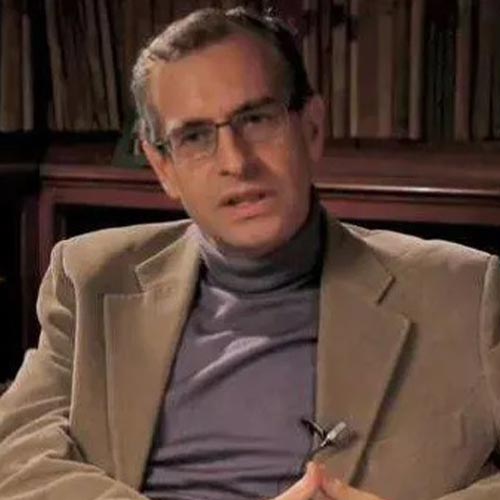
Carlo Lottieri
Professor für Wirtschaftswissenschaften, Università degli Studi di Verona

Thorsten Polleit
Professor für Ökonomie, Universität Bayreuth

Pascal Salin
Professor für Ökonomie, Université Paris-Dauphine

Gunther Schnabl
Professor für Ökonomie, Universität Leipzig

Roland Vaubel
Professor für Ökonomie, Universität Mannheim

Michael Wohlgemuth
Professor für Volkswirtschaftslehre, Universität Witten/Herdecke
Revisionsstelle
Marty Revision AG,
Luzern, Schweiz
Philosophie
Der Liberalismus wurzelt in der Skepsis gegenüber der Macht, dem Zwang, und damit auch dem Staat. Hier liegen auch die Wurzeln seiner zukunftsträchtigen und immer drängender werdenden Kraft. Freiheitsrechte, als Grundlage einer liberalen Ordnung, können nicht relativiert werden, ohne die Menschenwürde zu gefährden. Ihnen gebührt daher unsere besondere Rücksicht — und unser Engagement. Die Grundzüge einer liberalen Ordnung können anhand dreier einfacher Prinzipien beschrieben werden:
Den mündigen Menschen als Ursprung und Ziel begreifen
Jede liberale Ordnung steht und fällt mit dem Respekt vor der Eigenständigkeit der Person. Wo Zwang herrscht, soll sich Freiwilligkeit und Autonomie ausbreiten. Wenn aber Selbstverantwortung an Stelle von Fremdbestimmung und Regulierung treten soll, dann muss der „geordnete Rückzug“ aus entmündigenden — oft gut gemeinten — etatistischen Fehlstrukturen angetreten werden. Ausgangspunkt jeder freiheitlichen Ordnung ist somit der mündige Mensch, dem zugetraut wird, sein Leben eigenständig zu bestimmen.

Lösungen so privat und so bürgernah wie möglich erarbeiten
Die Freiheit und Autonomie eines Menschen erweist sich nicht in der Isolation, sondern in der Zusammenarbeit. Selbstbestimmung manifestiert sich daher in freiwilligen, vertraglichen Netzen der Kooperation. Wo bisher Zentralen herrschen, sollen vielfältige, dezentrale Einheiten den Wettbewerb pflegen. Zentralisierung ist eine Gefahr für Freiheit und Autonomie. Eine liberale Ordnung bedarf auch der Kraft und der Toleranz, sich gegenseitig Mündigkeit und Privatautonomie zuzumuten, die Vielfalt zu ertragen. Neben der Vielfalt der vertraglichen Zusammenarbeit ist dabei auch die Vielfalt non-zentraler offener politischer Einheiten unverzichtbar.

Freiwilliges Zusammenwirken ermöglichen
Freiheit ist die Voraussetzung wirkungsvoller Zusammenarbeit und Solidarität. Wo heute die entmündigenden, zentralistischen Zwänge des „Wohlfahrtsstaates“ fesseln, soll die spontane und gezielte Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft wirken. Der ungehinderte Austausch zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen ist ein Fundament der lebendigen Zivilgesellschaft. Wer Solidarität durch Zwang ersetzt, zerstört daher die Grundlagen der harmonischen Kooperation autonomer Menschen.
Die drei so beschriebenen Prinzipien — mündige, autonome Menschen, vertragliche und dezentrale Kooperation und freiwillige Solidarität — können als Leitlinien einer liberalen Ordnung verstanden werden. Sie sind daher auch die normativen Grundlagen der Aktivitäten des Liberalen Instituts.

Tradition
Das Liberale Institut steht in der Tradition des Schweizer Freiheitsverständnisses, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Damals verteidigten die Eidgenossen ihre Unabhängigkeit gegenüber der Steuertyrannei eines fremden Herrn, die sie durch eine freiwillige Gemeinschaft mit einem Mindestmass an gemeinsamen Regeln ersetzten. Diese — 1804 durch den grossen Dichter Friedrich Schiller bewegend dramatisierte — Geschichte widerspiegelt die beiden Komponenten der Freiheitsidee, das Spannungsfeld zwischen Auflehnung gegen Zwang und der Bereitschaft zur vertraglichen autonomen Bindung.
Eine universale Idee
Die Freiheit wurde natürlich nicht in der Schweiz erfunden — sie ist ein Bestandteil des kulturellen Erbes der Menschheit. Die liberale Machtskepsis steht am Ursprung jeder pluralistischen Gesellschaft, jeder innovativen und prosperierenden Wirtschaft, ja der Zivilisation als solcher. Sie findet ihren Ausdruck in der altjüdischen und griechischen Idee, dass auch der Herrschende an bestimmte moralische Normen gebunden sei und nicht souverän über unbeschränkte Zwangsbefugnis verfüge. Wie sich in einer Gesellschaft auch ohne staatlichen Zwang eine harmonische Ordnung spontan entwickeln kann, beschrieb der chinesische Philosoph Lao-Tse im 6. Jahrhundert v. Chr.
Germaine de Staël und Benjamin Constant
In der Schweiz erhielt die Freiheitsidee im späten 18. Jahrhundert durch Germaine de Staël, die Tochter des Genfer Bankiers Jacques Necker, neue Impulse. Sie führte einen einflussreichen europäischen Salon im Schloss Coppet und pflegte den Umgang mit namhaften Zeitgenossen im deutschsprachigen Raum wie Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe (der eines ihrer Essays übersetzte).
Jahrhundert durch Germaine de Staël, die Tochter des Genfer Bankiers Jacques Necker, neue Impulse. Sie führte einen einflussreichen europäischen Salon im Schloss Coppet und pflegte den Umgang mit namhaften Zeitgenossen im deutschsprachigen Raum wie Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe (der eines ihrer Essays übersetzte).  Engagiert plädierte sie dabei für gesellschaftlichen Pluralismus und gegen die verhängnisvolle Zentralisierung des Staates. Ähnliche Ideen vertrat auch ihr Gefährte Benjamin Constant — zweifellos einer der produktivsten Philosophen seiner Zeit. Constant entmystifizierte den Staat als eine blosse Zweckvereinigung von Menschen, die alleine der Wahrung individueller Freiheit dient.
Engagiert plädierte sie dabei für gesellschaftlichen Pluralismus und gegen die verhängnisvolle Zentralisierung des Staates. Ähnliche Ideen vertrat auch ihr Gefährte Benjamin Constant — zweifellos einer der produktivsten Philosophen seiner Zeit. Constant entmystifizierte den Staat als eine blosse Zweckvereinigung von Menschen, die alleine der Wahrung individueller Freiheit dient.
Ludwig von Mises, Wilhelm Röpke
 Im letzten Jahrhundert spielte die Schweiz als Hort der Freiheit in einem im Kollektivismus und in staatlichen Exzessen versinkenden Europa eine Schlüsselrolle. 1934 bot das von William Rappard geführte Genfer Institut des Hautes Etudes Internationales dem grossen österreichischen Ökonom Ludwig von Mises ein Refugium. Hier verfasste er sein unentbehrliches Meisterwerk „Nationalökonomie.
Im letzten Jahrhundert spielte die Schweiz als Hort der Freiheit in einem im Kollektivismus und in staatlichen Exzessen versinkenden Europa eine Schlüsselrolle. 1934 bot das von William Rappard geführte Genfer Institut des Hautes Etudes Internationales dem grossen österreichischen Ökonom Ludwig von Mises ein Refugium. Hier verfasste er sein unentbehrliches Meisterwerk „Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens“, welches 1940 veröffentlicht wurde. An das gleiche Institut stiess 1937 der deutsche Ökonom Wilhelm Röpke. In Genf brachte er seine grundlegende Sozialphilosophie zu Papier — und verteidigte in der öffentlichen Debatte durch die Neue Zürcher Zeitung die Idee der Freiheit.
Theorie des Handelns und Wirtschaftens“, welches 1940 veröffentlicht wurde. An das gleiche Institut stiess 1937 der deutsche Ökonom Wilhelm Röpke. In Genf brachte er seine grundlegende Sozialphilosophie zu Papier — und verteidigte in der öffentlichen Debatte durch die Neue Zürcher Zeitung die Idee der Freiheit.
F. A. von Hayek und die Mont Pèlerin Society
 Als es schliesslich galt, auf den Trümmerfeldern Europas die intellektuelle Wiedergeburt der Zivilisation zu begründen, versammelte der Ökonom (und spätere Nobelpreisträger) Friedrich August von Hayek 1947 in Mont-Pèlerin oberhalb Veveys 39 führende liberale Persönlichkeiten — darunter L. von Mises, W. Rappard und W. Röpke. Mit der Mont Pèlerin Society wurde hier eine akademische Vereinigung geboren, welche heute weltweit mehr als 700 liberale Denker und Praktiker zu ihren Mitgliedern zählt. F. A. von Hayek veröffentlichte ferner in Zürich die erste deutschsprachige Ausgabe seines einflussreichen Werkes Der Weg zur Knechtschaft. 1947 bis 1959 publizierte er einige seiner wichtigsten Aufsätze in den Schweizer Monatsheften.
Das Liberale Institut trägt seit 1979 die umfassende intellektuelle und humanistische Tradition der macht-, staats- und zentralismusskeptischen Freiheitsidee weiter und hat sich die Aufgabe gesetzt, sie auch im 21. Jahrhundert mit Leben zu füllen.
Als es schliesslich galt, auf den Trümmerfeldern Europas die intellektuelle Wiedergeburt der Zivilisation zu begründen, versammelte der Ökonom (und spätere Nobelpreisträger) Friedrich August von Hayek 1947 in Mont-Pèlerin oberhalb Veveys 39 führende liberale Persönlichkeiten — darunter L. von Mises, W. Rappard und W. Röpke. Mit der Mont Pèlerin Society wurde hier eine akademische Vereinigung geboren, welche heute weltweit mehr als 700 liberale Denker und Praktiker zu ihren Mitgliedern zählt. F. A. von Hayek veröffentlichte ferner in Zürich die erste deutschsprachige Ausgabe seines einflussreichen Werkes Der Weg zur Knechtschaft. 1947 bis 1959 publizierte er einige seiner wichtigsten Aufsätze in den Schweizer Monatsheften.
Das Liberale Institut trägt seit 1979 die umfassende intellektuelle und humanistische Tradition der macht-, staats- und zentralismusskeptischen Freiheitsidee weiter und hat sich die Aufgabe gesetzt, sie auch im 21. Jahrhundert mit Leben zu füllen. Röpke-Preis für Zivilgesellschaft
Der Röpke-Preis für Zivilgesellschaft soll jeweils eine Leistung und Haltung anerkennen, die mit den Anliegen des grossen Ökonomen, und damit jenen des Liberalen Instituts, in Verbindung stehen. Damit soll auch ein Zeichen der Dankbarkeit und Freude gesetzt werden, dass die freiheitliche Kultur in der Schweiz vielfältig und lebendig bleibt. Der Röpke-Preis wird jährlich im Rahmen der Freiheitsfeier des Liberalen Instituts vergeben.
Über die Entstehung des Röpke-Preis
Der Ökonom und Sozialphilosoph Wilhelm Röpke (1899-1966) gehört zu den bedeutendsten Vertretern des Liberalismus in der jüngsten Schweizer Geschichte. Sowohl im Rahmen seiner Lehrtätigkeit am Genfer Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales als auch im Rahmen seiner zahlreichen Buchpublikationen und Meinungsbeiträge in der Schweizer Presse verteidigte er engagiert und eloquent die individuelle Freiheit, die Marktwirtschaft und eine dezentrale Ordnung. Dies in einer Zeit, in der zahlreiche Zeitgenossen mit den Versprechungen totalitärer Ideologien sympathisierten oder einer «pragmatischen Anpassung» an diese das Wort redeten.
Wilhelm Röpke steht darum noch heute für Mut, konsequente Freiheitsliebe und kreative Dissidenz. Nach Röpke erfordert der Erhalt einer liberalen Ordnung und lebendigen Zivilgesellschaft, dass individuelle Bürger freiheitliche Werte und Normen in ihrem Alltag respektieren und anwenden. Mit dem Röpke-Preis für Zivilgesellschaft zeichnet das Liberale Institut daher Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur aus, die durch ihre Tätigkeiten die Präsenz freiheitlicher Ideale in der Gesellschaft stärken.
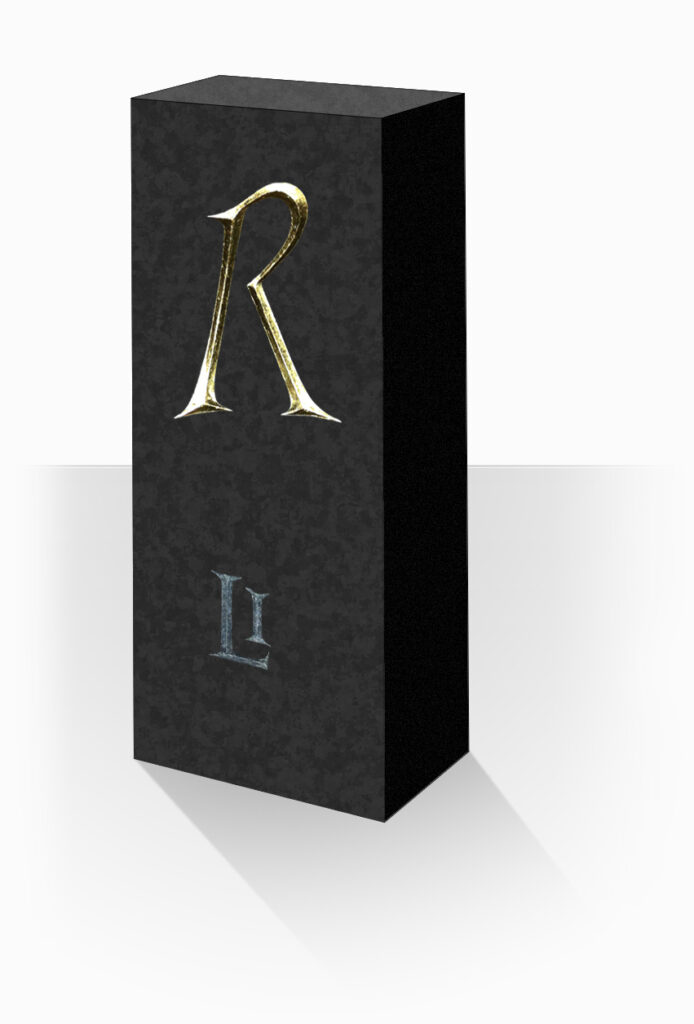
Zu den bisherigen Preisträgern des Röpke-Preises für Zivilgesellschaft zählen:
Suzette Sandoz
für ihren langjährigen und unerschrockenen Einsatz für die liberale Sache im etatistischen Meinungsklima
Rede der Preisträgerin: «Hat der Neoliberalismus den Liberalismus beseitigt?»
Dominik Feusi
für seinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Debattenkultur und die beharrlich auf liberale Werte ausgerichtete Publizistik
Rede des Preisträgers: «Schützt die Zivilgesellschaft vor dem Leviathan».
Werner Widmer
für seinen Beitrag zur Aufwertung der Eigenverantwortung im Gesundheitsdiskurs
Rede des Preisträgers: «Gesundheit und Eigenverantwortung».
Die Rede kann hier auch als Video angeschaut werden.
Gerhard Schwarz
für seine zukunftsgerichteten Reformansätze in Anbetracht der traditionellen institutionellen Trümpfe der Schweiz
Video der Preisverleihung und der Rede des Preisträgers.
Tobias Straumann
für seine praxisnahe Verständigung wirtschaftlicher Zusammenhänge und der marktwirtschaftlichen Grundlagen von Wohlstand
Artikel von Tobias Straumann: «Sind wir so reich, weil die andern so arm sind?»
Martin Lendi
für seinen Beitrag zugunsten einer lebendigen Kultur des Rechts als Grundsatz des friedlichen und prosperierenden Zusammenlebens
Rede von Martin Lendi: «Freude am Recht»
Franz Jaeger
für seine wissenschaftlichen Ansätze zugunsten einer dezentralen Ordnung und wirtschaftspolitischer Vernunft
Interview mit Franz Jaeger: «Die EU hat den falschen Weg eingeschlagen»
Andreas Oplatka
für seine qualitativ herausragende, konsequent auf freiheitliche Werte ausgerichtete Publizistik
Rede von Andreas Oplatka: «Freiheit erfahren»
Victoria Curzon Price
für ihre Verteidigung des internationalen Steuer- und Regulierungswettbewerbs und eines wettbewerbsfähigen Föderalismus‘
Rede von Victoria Curzon Price: «The European Union’s Icarus Complex»
Peter Bernholz
für sein unermüdliches Einstehen für den Wert der individuellen Freiheit und Rechtsstaatlichkeit im öffentlichen Diskurs
Aufsatz von Peter Bernholz: «Der langsame und heimliche Weg zur Knechtschaft»
Charles Blankart
für seine Verdienste um eine konstruktive Beteiligung der Wissenschaft am öffentlichen Diskurs und seinen Beitrag zur wirtschaftspolitischen Aufklärung
Rede von Charles B. Blankart: «Die ordnungspolitische Rolle des Ökonomen»
Bruno Frey
für seine Erkenntnisse zu den Folgen der Zentralisierung im europäischen Verhältnis
Artikel von Bruno S. Frey: «Europas Zukunft: Weg mit dem Nationalstaat»
Beat Kappeler
für sein Engagement zugunsten einer Ethik der Selbstverantwortung und gegen sozialstaatliche Entmündigung
Rede von Beat Kappeler: «Des Westens unablässiges Gleiten auf schiefer Ebene — und die Abhilfe der Liberalen»
Karl Reichmuth
für sein Engagement zugunsten eines gesunden Geldwesens und gegen die Auswirkungen der Inflation
Rede von Karl Reichmuth: «Geld regiert die Welt, wer regiert das Geld?»















