
Die zunehmende Regulierungsdichte wird mehr und mehr zu einem ernsthaften Problem für Wohlstand, Innovation und Lebensstandard. Obwohl sich Politik und Wirtschaftsverbände seit Jahrzenten zu einem schlanken Staat und weniger Bürokratie bekennen, gelingt es bislang nicht, die Regulierungsflut auf allen Staatsebenen zu entschleunigen — geschweige denn, sie zu stoppen. An der LI-Konferenz vom 25. September, die zugleich der öffentliche Auftakt weiterer Arbeiten des Instituts in diesem Gebiet war, wurden die Ursachen einer immer umfassenderen staatlichen Regulierung erörtert, sowie nach neuartigen Rezepten gesucht, die das Problem an der Wurzel zu packen vermögen.
In seiner Einführung erinnerte LI-Direktor Pierre Bessard an die Tatsache, dass die mögliche Begrenzung staatlicher Regulierung schon eine Besorgnis der ersten liberalen Verfassungstheoretiker war, die zwei natürliche Neigungen beim Gesetzgeber identifiziert hatten: den Drang, etwas zu tun, was auch immer es sei, und die Freude, sich als wichtig und notwendig zu fühlen. Heute ist das Problem besonders akut auf Bundesebene, denn der Standortwettbewerb und die kurzen Wege in den Gemeinden und Kantonen ermöglichen nicht selten vernünftige Lösungen mit den lokalen Verwaltungen. Sich mit Ansätzen für weniger staatliche Regulierungen auseinanderzusetzen ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass die Regulierungsdichte mit dem Wirtschaftswachstum negativ korreliert, sondern auch weil dadurch das freie Unternehmertum und allgemeiner die individuelle Freiheit und Eigentumsverfügung beeinträchtigt werden. Auch muss verdeutlicht werden, dass staatliche Regulierung meist überschätzt, die Rolle von vertraglichen Abmachungen, industrieeigenen oder firmenspezifischen Regelwerken, d.h. privater Selbstregulierung — neben dem Wettbewerb als Disziplinierungsinstanz — jedoch oftmals unterschätzt wird.
In einem ersten Referat erörterte Beat Brechbühl, Rechtsanwalt und geschäftsführender Vizepräsident des Stiftungsrates der Bonny-Stiftung für die Freiheit, zunächst mögliche Ursachen der Regulierungsflut. Er nannte unter anderem die Skepsis gegenüber Verträgen zwischen freien Individuen, weshalb sich der Staat unter anderem auf dem Arbeitsmarkt zunehmend mit obligatorischen GAVs und flankierenden Massnahmen einmische. Der schweizerische Perfektionismus und der «Swiss Finish» führen zudem dazu, dass selbst reine Empfehlungen auf internationaler Ebene von der Schweizer Politik als verbindlich betrachtet und musterschülerhaft umgesetzt werden. Die Risikoaversion bei der Exekutive, welche die Sicherheit der Chance vorzieht, und das Vierjahresdenken der Legislative, die einen Vorstoss- und Gesetzesaktivismus entwickelt, um Aufmerksamkeit bei den Wählern zu generieren, stellen ebenfalls nennenswerte Faktoren dar. Auch werden bei Exzessen und Verfehlungen Einzelner — beispielsweise bei überhöhten Salären oder Hundebissen — überhastet allgemeinverbindliche Gesetze geschaffen, welche neue Probleme für alle generieren. Brechbühl plädierte deshalb für den «Mut zur Regulierungslücke»: Der Gesetzgeber sollte sich vielmehr auf die Rahmengesetzgebung konzentrieren, wie dies Eugen Huber beim ZGB getan hatte, um genügend Raum für Einzelfallgerechtigkeit zu wahren. Jedes Gesetz sollte zudem ein Verfalldatum haben, weil sich die Umstände ohnehin ständig ändern und unnötige Gesetze so automatisch wegfallen. Auch empfiehlt sich ein «Opting-Out» für lokal agierende Unternehmen, die nicht derselben Gesetzgebung unterworfen werden müssen wie multinationale Unternehmen.
In seinen Aufführungen gab Prof. Rudolf Minsch, Chefökonom und Mitglied der Geschäftsleitung von Economiesuisse, selbstkritisch zu bedenken, dass die Wirtschaft die Regulierungsflut nicht mit einer Stimme bremse und teilweise auch selbst schuld an der heutigen Lage sei. Das zurückhaltende Auftreten der Unternehmen bei der Bekämpfung der Überregulierung hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass ein Übermass an Gesetzen und Verordnungen für Grossunternehmen einen Wettbewerbsvorteil darstellen, weil sie im Gegensatz zu kleinen Unternehmen aufgrund ihrer ausgebauten Compliance-Abteilungen besser mit aufgeblähter Regulierung fertigwerden und deshalb gut damit leben können. Dies führt dazu, dass die Schweiz zunehmend schlechtere Bedingungen bietet, um unternehmerisch tätig zu werden und Wohlstand zu schaffen. Diese besorgniserregende Tatsache wird durch das Zurückfallen der Schweiz in diversen Indexen wie etwa dem Doing Business-Index der Weltbank verdeutlicht. Wichtig ist deshalb, darauf zu pochen, dass die Politik das Vernehmlassungsverfahren wieder ernstzunehmen hat, weil so sämtliche Akteure, die von einer Regulierung betroffen sind, einbezogen und die schlimmsten Zähne bereits dort gezogen werden können. Beamte sollten nach dem Studium zunächst mindestens drei Jahre in der Privatwirtschaft arbeiten müssen, bevor sie sich beim Staat bewerben dürfen, um damit das Verständnis und das Bewusstsein für die Probleme privater Unternehmer mit der Überregulierung zu schärfen. Letztlich gilt es auch, beim staatlichen Personal Einsparungen zu machen, zumal weniger Zeit und weniger verfügbare Gelder beim Staat auch zu weniger Regulierungs-Aktivismus führen.
In seinem Referat ging Rahim Taghizadegan, Rektor und Gründer des Forschungsinstituts Scholarium in Wien, den Anreizen der Bürokratie auf den Grund. Unter anderem die Tatsache, dass Wien als Hauptstadt heute trotz der enormen Schrumpfung des Landes vom einstigen Imperium Österreich-Ungarn zum heutigen Österreich immer noch gleich viele Beamte beschäftigt, gibt dem Parkinsons Gesetz einmal mehr recht. Bürokratie ist vergleichbar mit Gas, welches jedes vorhandene Volumen ausfüllt. Nur wer die Anreize der Bürokratie versteht, ist in der Lage, wirksame Reformen zu deren Eindämmung aufzugleisen. Ludwig von Mises war der Ansicht, dass es in Bezug auf die Ausbreitung der Bürokratie nicht darauf ankomme, ob man die tüchtigsten und besten Menschen in die führenden Verwaltungspositionen hieve, weil der fehlende Erfolgsmassstab des Gewinns und Verlusts sowie die vom Souverän vorgegebenen Regeln, denen sich alles unterordnen muss, jeglichen innovativen Erfinder- und Unternehmergeist abtöten. Daher ist Vorsicht geboten: Anreize, die sich im freien Markt bewährt haben, lassen sich nicht einfach auf die Bürokratie übertragen. Die Implementierung von mehr Wettbewerb beispielsweise kann sich sogar negativ auswirken: Während Wettbewerb in der Privatwirtschaft dem Kunden zugutekommt, schadet Wettbewerb zwischen Beamten den Bürgern — beispielsweise dann, wenn mehrere Steuerkommissare untereinander wetteifern, wer die höheren Steuereinnahmen von einem Unternehmen eintreiben kann. Folglich ist der Abbau der Bürokratie infolge einer Entstaatlichungskur sämtlicher Bereiche zielführender als das Setzen falscher Anreizen.
In der anschliessenden Diskussion widmete man sich unter anderem der Frage, wie nun die von den Referenten vorgestellten Lösungsansätze in der Praxis umgesetzt werden könnten. Eine wesentliche Vorbedingung, damit dies gelingen kann, ist das Vorhandensein eines ordnungspolitischen Kompasses bei den Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit sowie das Bewusstsein über die Anreize der Bürokratie. Weil dieser Kompass und dieses Bewusstsein in den letzten Jahrzehnten zunehmend verkümmerte, stehen heute zunächst Arbeiten zur Aufklärung im Vordergrund. Das Liberale Institut wird sich dieser Aufgabe auch in Zukunft mit Entschlossenheit annehmen, um einen entscheidenden Beitrag zu leisten, damit die staatliche Regulierungsflut wieder zurückgedrängt werden kann und die notwendigen Entstaatlichungsmassnahmen besser wahrgenommen werden.
Tags:
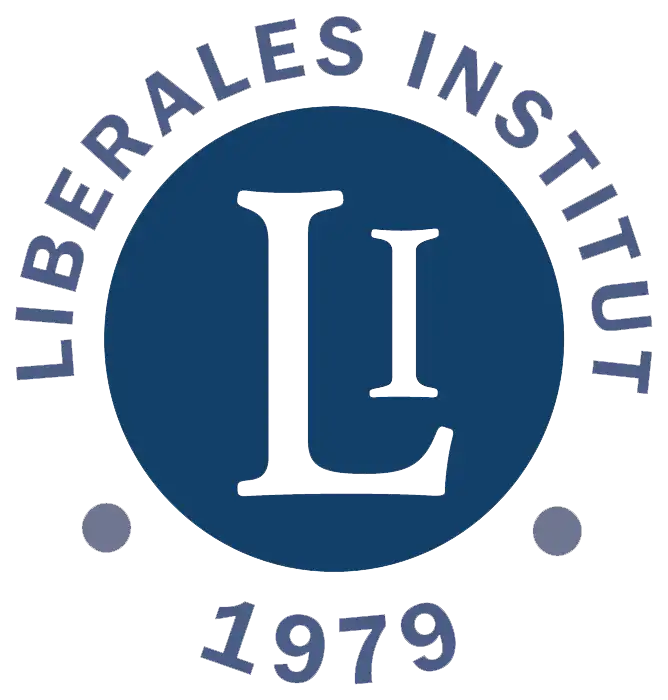
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.