
Man tut dem deutschen Liberalismus in seiner klassischen Phase im 19. Jahrhundert wohl keine allzu grosse Gewalt an, wenn man ihn als tendenziell zentralistisch interpretiert. Auch wenn man doch aus heutiger Sicht dazu neigen würde, die Idee des beschränkten «kleinen» Staates (die Kernidee des klassischen Liberalismus) und die Idee des physisch «kleinen» Staates als ein sich ergänzendes «Zwillingspaar» zu betrachten, so sahen dies die meisten deutschen Liberalen ganz anders.
Hier zeigt sich, dass unser heutiges Liberalismusverständnis sehr stark von Amerika geprägt ist, wo Freiheitstradition und Non-Zentralismus immer schon zusammengehörten. In Amerika ist der Zusammenhang von dezentralen, föderalen Strukturen und (Markt-) Freiheit immer wesentlich klarer gesehen worden. Das mag nicht nur etwas damit zu tun haben, dass dort die Einzelstaaten historisch klar vor dem Bundesstaat existierten, sondern dass diese auch als freiheitliche Gemeinwesen überaus stark legitimiert waren. Es war von vornherein eine eher neo-merkantilistisch, teils kryptomonarchisch orientierte Partei, die sich unter dem (für Deutsche stets irreführenden, weil von ihnen nicht mit Zentralismus verbundenen) Namen «Federalists» für die Annahme der Bundesverfassung 1787/88 stark machte. Der Zentralismus hat in Amerika stets auch den Hauch des Undemokratischen. In Deutschland war die Lage anders. Dort hatte man im 19. Jahrhundert durchaus in einigen Fällen Grund, die vermeintliche «Kleinstaaterei» als Bollwerk anti-liberaler Interessen mit absolutistisch-merkantilistischem Anstrich zu sehen. Gerade der klassische, marktwirtschaftliche Liberalismus erscheint in der deutschen Geschichte meist als hartnäckiger Gegner des Föderalismus, wenn nicht gar als expliziter Befürworter eines nationalstaatlichen Zentralismus. Wegen der Verbundenheit des Non-Zentralismus mit den absolutistischen Regimen der Zeit nach dem Wiener Kongress war es vielen liberalen Reformern wohl kaum möglich, die liberalen Potentiale zu erkennen, die in einer nicht-zentralistischen Struktur steckten.
Man kann im wesentlichen drei Faktoren ausmachen, die viele (wenngleich nicht alle) Liberale dazu verleitete, dem Zentralismus zu frönen: der Nationalismus, der Marktliberalismus und das Erbe der Französischen Revolution.
Die militärische Schwäche und Ineffizienz der deutschen Staaten gegenüber der französischen Eroberungspolitik zur Zeit der französischen Revolution und Napoleons hatte in den Jahren nach 1815 dazu geführt, dass sich liberale und nationalistische Reformkräfte vereinigten. Sie konnten sich dabei durchaus auf aufklärerische Wurzeln stützen, denn im 18. Jahrhundert hatte sich unter den Gelehrten (man denke an Christian Thomasius) die prinzipiell richtige Idee verbreitet, dass das Aufklärungswerk nur Erfolg haben könne, wenn man zum Beispiel die deutsche Sprache pflegte und bei der Verbreitung der allgemeinen Grundsätze auch allgemein — und dies hiess auch: über die jeweiligen kleinstaatlichen Grenzen hinaus — verständlich für die «einfachen Menschen» wurde.
Die im politischen Sinne erfolgreiche Allianz zwischen Liberalismus und Nationalismus des 19. Jahrhunderts konnte (wenn auch aus verschiedenen Gründen) sich stets über einen gemeinsamen Gegner in Form der absolutistischen Kleinstaaten definieren. Die Frage, ob denn nicht zwischen dem kollektiven nationalen und dem individuellen liberalen Freiheitsbegriff Spannungen bestehen könnten, wurde überspielt. In der Realität ging dies meist zu Lasten des liberalen Freiheitsbegriffs. Die passend so genannte Nationalliberale Partei verdankte sogar ihre Existenz als die über Jahrzehnte hinweg erfolgreichste «liberale» Partei der Tatsache, dass sie 1866 nachträglich der Bismarckschen Heeresreform zustimmte. Damit stimmte sie einem eklatanten Verfassungsbruch zu (seit 1862 hatten die Liberalen nämlich im Landtag die dazu gehörenden Finanzmittel verweigert, worauf Bismarck ohne parlamentarische Zustimmung die Reform durchführte). Eine solchermassen dubios eingeleitete Verbindung mit dem Konservativen Bismarck schien dieser Partei der richtige Weg zur Erringung der nationalen Einheit und eine Rechtfertigung zum Fallenlassen liberaler Prinzipien zu sein. Es waren dieselben Nationalliberalen, die 1878 (also nach der Reichseinigung) dann auch der Bismarckschen Abkehr vom Freihandel und später der Sozialgesetzgebung zustimmten. Selbst die insgesamt prinzipientreueren Fortschrittsliberalen waren bisweilen bereit, bei der Wahl zwischen Liberalismus und Nationalismus für Letzteren zu optieren. Sogar ein so eherner «Manchesterliberaler» wie Hermann Schulze-Delitzsch konnte sagen, man brauche «erst die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, ehe an den Ausbau der inneren Zustände im einzelnen gedacht werden kann.»
Noch ein anderer – diesmal rein ökonomischer – Gedankengang schien für viele deutsche Liberale eine stärkere Zentralisierung sinnvoll zu machen. Politische Zersplitterung stelle, so hiess es, dem freien Markt zu viele Hindernisse in den Weg. Vereinheitlichung aller Standards auf einem möglichst grossen Staatsgebiet sei die Lösung. Dieses Argument, das bei der Diskussion um die Vertiefung der Europäischen Union im Gewande der «Harmonisierung» wieder fröhliche Urstände feiert, wirkt auf den ersten Blick plausibel. Dass mehr Vereinheitlichung die Marktfreiheit befördere, glauben daher viele Marktliberale des 19. Jahrhunderts — etwa der Manchesterliberale Ludwig Bamberger, der in der «Einheit… selbst ein Stück Freiheit» sah.
Gerade die deutsche Geschichte lehrt natürlich etwas anderes. Die eigentliche Zeit der Marktlibera-lisierung lag hier vor der Reichseinigung von 1870/71. Sie erreichte mit der Schaffung des Zollvereins 1833 innerhalb des extrem dezentralen politischen Systems in Deutschland ihren ersten Höhepunkt. Von den 1840er Jahren an begann die grosse Zeit der Freihandelsbewegung, die fast konkurrenzlos die wirtschaftspolitische Agenda bestimmte. Nach der Reichseinigung setzte hingegen ein aggressiver Protektionismus und sozialpolitischer Interventionismus ein. Einige nationalliberale Ökonomen wie Friedrich List in seinem «Nationalen System der Ökonomie» (1841) hatten diese Hinwendung zum Protektionismus auch bewusst angestrebt. Die meisten Marktliberalen dürften sie jedoch kaum begrüsst haben. Sie zeigten sich zwar früh über den durch Sozialismus produzierten Zentralismus entsetzt wie etwa Eugen Richter, der in seinem 1890 erschienenen Buch «Die Irrlehren der Sozialdemokratie» monierte, dass in einem sozialistischem System «keinem Zwischengliede, keiner örtlichen Stelle… eine selbständige Entscheidung zugemessen werden» könne. Dass umgekehrt der Zentralismus auch sozialistische und protektionistische Tendenzen produzieren könnte, wurde indes kaum je analysiert. Dies blieb in aller Klarheit erst Wilhelm Röpke vorbehalten, der in seinem Buch «Internationale Ordnung» 1954 vor der «Hypertrophie des Nationalstaates» warnte. Der Föderalismus schien ihm das organische Gegenbild zu sozialistischen Grossutopien.
Das moderne Konzept des Wettbewerbsföderalismus — politischer Wettbewerb der Standorte stärkt den wirtschaftlichen Wettbewerb — war den Marktliberalen des 19. Jahrhunderts weitgehend fremd. Es ist wiederum eindeutig ein «Import» aus Amerika, der insbesondere durch die Etablierung der «Public Choice»-Theorien (James Buchanan/Gordon Tullock u.a.) an den deutschen Wirtschaftsfakultäten vorangetrieben wurde.
Trotz des latenten (oder meist auch offenen) antifranzösischen Impulses, der hinter dem nationalen Liberalismus in Deutschland steckte, haben Liberale (anfänglich der Not gehorchend) vielfach den Zentralismus der französischen Republik als Vorbild erkoren. Der französische Zentralismus und Verwaltungsstaat galt als Inbegriff der Moderne (und als das einzige Mittel, mit dem man wiederum Frankreich schlagen konnte). Daher verdient das Erbe der Französischen Revolution besondere Beachtung.
Eine der Wurzeln des liberalen Hangs zum Zentralismus liegt in dem naturrechtlichen Individualismus, der ja Produkt des universalistischen Aufklärungsgedankens war. Turgot, der Adam Smiths Lehren wesentlich beeinflusste, brachte dies 1757 in einem Artikel der Diderot’schen «Encyclopaedie» auf den Punkt. Der Staat habe, so meinte er, das Recht, jedes «corps particulier» (Teilkörperschaft) aufzuheben. Diese ge- fährdeten nämlich in einem Staat, der seine Souveränität unmittelbar aus den heiligen Rechten des einzelnen beziehe, nur die Universalität eben dieser Rechte. Diese Anschauungen galten nicht nur für Turgot. Die ganze physiokratische Schule der Ökonomie, die im Frankreich der vor-revolutionären Zeit des 18. Jahrhunderts mit der Parole «laissez faire, laissez passer» die Marktbefreiung betreiben wollte, war von diesem Denken durchdrungen. Deshalb wollte man den Absolutismus zunächst auch nicht abschaffen, sondern stärken, um so das gewünschte Reformprogramm kohärent durchführen zu können. Ein physiokratischer Ökonom nach dem anderen versuchte sich daher als Hauptberater Ludwigs XVI. – Turgot, Necker, Calonne seien genannt. Das Scheitern war vorprogrammiert. Die von ihnen gewollte Liberalisierung wurde durch den illiberalen Zentralismus der absoluten Monarchie letztlich verhindert.
Dadurch, dass die Französische Revolution den Zentralismus des vorherigen absolutistischen Regimes übernahm, folgte auch ein Grossteil des europäischen Liberalismus im 19. Jahrhundert eher dem «Turgot’schen Muster». Die Französische Revolution machte die Sache des Zentralismus im Namen der Menschenrechte so sehr zu der eigenen, dass selbst eine vermutete Gegnerschaft dazu gefährlich werden konnte. Die gemässigten Girondisten wurden nicht zuletzt deshalb während des Robespierreschen Terrors auf die Guillotine geschickt, weil man ihnen «föderalistische» Anschauungen nachsagte. Mehr noch: durch die Französische Revolution wurde das Modell des (mehr oder minder) demokratischen Zentralismus zum «Exportschlager» und beeinflusste fast überall zentralistische Modernisierungsvorhaben (z.B. die Helvetik in der Schweiz). In Deutschland verstärkte dies den bereits durch den Nationalismus vorgegebenen Impuls zur Zentralisierung.
Dies deutet letztlich auf ein Paradox des zentralistischen Liberalismus hin. Sein naturrechtlicher und marktwirtschaftlicher Grundansatz war zwar eigentlich zutiefst anti-etatistisch, er konstituierte aber auch im gleichen Masse den Etatismus. Der konservative deutsche Schriftsteller Constantin Frantz konnte daher 1879 in seinem Buch «Der Föderalismus» nicht ohne Häme feststellen: «Den Regierungsabsolutismus gebrochen zu haben, ist das unstreitige Verdienst des Liberalismus. Wirkliche Volksfreiheit war damit noch lange nicht begründet. Im Gegenteil, der Absolutismus nahm damit nur eine andere Gestalt an: er wurde zum Staatsabsolutismus, der in vieler Hinsicht unter dem liberalen Regime erst recht emporgekommen ist.»
Zumindest die Ableitung des Zentralismus aus dem universalen Naturrechtsgedanken und der Idee des individuellen Selbstbestimmungsrechtes hat aber schon früh Widerspruch geerntet. Während der zentralisierende Nationalismus und das Argument der politischen Marktstandardisierung merkwürdig unhinterfragt blieben, gab es immer eine Tradition in Deutschland, die gerade Non-Zentralisation als Gebot von Individual- oder zumindest Volksrechten sah. Sie verdient nähere Betrachtung.
Die Vertreter dieser Tradition zeigten auf, dass der zentralistische Schluss durchaus nicht logisch aus den naturrechtlichen Prämissen folgen musste. Der grosse Pionier dieser Denkrichtung in Deutschland wirkte noch in vorliberaler Zeit. In seiner «Politica» von 1603 argumentierte der grosse deutsche Rechtsgelehrte Johannes Althusius (1557—1638), der wohl wichtigste deutsche Theoretiker des neuzeitlichen Föderalismus, mit gutem Grund genau umgekehrt wie Turgot. Die kleine Gemeinschaft (etwa die Familie) basiere meist auf konsensualer Freiwilligkeit und sei so naturrechtlich abgesichert. Jede höhere Ebene, die Zwang etabliere, müsse daher durch die untere Ebene legiti-miert werden. So bliebe jegliche staatliche Macht als gebundenes «Delegat» (nicht souveränes «Mandat») an das eigentliche Recht des als Gemeinschaftswesen definierten Menschen gebunden und wird von unten nach oben abgeleitet (womit der moderne Subsidiaritätsgedanke in einer sehr konsequenten Form vorweggenommen ist). Althusius hat so nicht nur in systematisierender Anlehnung an mittelalterliche Rechtsideen den föderalen Gedanken konsequent an das Naturrecht gebunden, sondern sein Konzept ermöglicht die Existenz subsidiärer Residuen, in denen die Freiheit gegen die Allmacht des Staates geschützt werden kann. Diese überaus konsequente Verbindung von Naturrecht und Dezentralisierung geht wohl eindeutig auf Althusius‘ calvinistische Glaubensvorstellungen zurück, die schon im Bereich der Kirchenverfassung stets die Gemeinde als Sitz aller Souveränität betrachten.(1)
Besonders im Südwesten Deutschlands (aber nicht nur dort, wie die preussischen Reformen des Freiherr vom Stein nach 1806 zeigen, in deren Mittelpunkt die lokale Selbstverwaltung stand), in Baden und in Württemberg, bildete sich im Vormärz eine gemässigt liberale Denkrichtung, die bald durchaus politischen Einfluss erlangte, und die dezidiert vom Zentralismus anderer liberaler Strömungen abwich. Ihr «Vordenker» war der württembergische Jurist Johann Jakob Moser (1701—1785), der durch sein 83-bändiges Werk «Teutsches Staatsrecht» berühmt wurde. Er nahm eine längere Festungshaft in Kauf, um (am Ende erfolgreich) gegen die Aufhebung der alten Rechtsinstitutionen — Landtage, Stände, Gemeindetage — durch den zum Absolutismus neigenden Herzog Karl Eugen zu protestieren. Für ihn waren die lokalen Instanzen ein Bollwerk gegen Willkür und Garant einer von untern gewachsenen «uralten teutschen angeborenen Freiheit».
Der daraus erwachsende Liberalismus war schon deshalb gegen die zentralistische Naturrechtsinterpretation der Französischen Revolution immun, weil er generell bewusst antirevolutionär war. Er stellte das «ursprüngliche» alte Recht (altgermanisches Stammesrecht) in den Mittelpunkt, das die Freiheiten der Bürger einst konstituiert hatte. Dieses war (wie bei Althusius) deshalb ein freiheitsschützendes Recht, weil es in der Konsensgemeinschaft entstanden war. Der Dichter Ludwig Uhland (1787-1862), der später zu den führenden Mitgliedern der Paulskirchenversammlung gehörte, war einer der Hauptvertreter der Schule, die heute meist als «altrechtliche Schule» bezeichnet wird. Ähnlich wie es antirevolutionäre Schriftsteller in England getan hatten (etwa Edmund Burke), wollten die «Altrechtler» die Freiheit nicht in den Dimensionen eines aggressiven Universalismus, sondern als Erbrecht und besonderes Eigentumsrecht definieren. Man wollte wohl bewusst ein Pendant zu dem sehr wirksamen Begriff der «Anglo-Saxon Liberty» schaffen.
Die Idee, auf ein «altes Recht» zurückzugreifen, konnte mit einigen liberalen Zielvorstellungen der Zeit kollidieren, wenn es etwa um die Bewahrung zünftischer Relikte im Staatswesen ging, die ein veritables Hindernis für die Wirtschaftsfreiheit waren.
Wenn es je genuine Ansätze gegeben hat, eine echte, und dennoch genuin deutsche Freiheitstradition zu entwickeln, dann stellt die «Altrechtsschule» einen der wichtigsten und erfolgversprechendsten Versuche dar. Sie hätte die ja schliesslich in Deutschland tiefverwurzelte föderalistische Tradition als Vehikel für den Liberalismus nutzen können.(2)
Schon in den Ideen der Altrechtler à la Uhland wird die geistige Anlehnung an das «Modell» der Schweizer Eidgenossenschaft deutlich sichtbar. Dass dieses «Modell» auch bald in der deutschen Staatsrechtslehre einen gewichtigen Platz einnehmen sollte, dafür bedurfte es eines echten Schweizer Imports: Johann Kaspar Bluntschli (1808-1881) hatte im Sonderbundskrieg 1847 in Zürich auf der «falschen» Seite (der konservativen, dezentralistischen) gestanden, und war nach Baden ausgewandert, wo er Professor für Staatsrechtsrecht und als gemässigter Liberaler Mitglied der Ersten Kammer wurde. Sein Buch «Statsrecht» von 1851 wurde zum vielfach aufgelegten juristischen Standardwerk an deutschen Universitäten. Der Staat war bei ihm schon zweifellos mehr als nur ein Delegat, das völlig abhängig von nicht-staatlichen Gemeinschaften war. Souveränität war bei ihm das Hauptkennzeichen des Staates. Er war gewiss kein Libertärer im modernen, amerikanischen Sinne. Trotzdem war er ein Anhänger eines starken und unabhängigen Lokalismus.
Der Genossenschaftsgedanke unterscheidet sich deutlich von der heutigen «hoheitlichen» Funktion der Gemeinden. Er ist privatrechtlicher Natur und basiert auf dem Prinzip der Unabhängigkeit — also ohne Mischfinanzierungen und Subventionen von oben (der Staat hat lediglich Aufsichtsfunktion) — und so etwas wie gegenseitige Haftung. Die Gemeinde kommt damit einer auf Eigentum basierenden Einheit im modernen libertären Sinne sehr nahe. In seiner ursprünglichsten und echtesten Form wird das «Bürgerrecht zu einem Erbgute», das exklusive Nutzung einschliesst.(3) Ganz klar hat Bluntschli dabei die lokale Direktdemokratie in der Schweiz vor Augen, deren Volksversammlungen durchaus Ähnlichkeiten mit genuinen Eigentümerversammlungen haben. Allerdings sieht Bluntschli, dass dieses Ideal in seiner Zeit nicht immer haltbar ist (etwa in Grossstädten und Gemeinden mit grosser Einwohnerfluktuation), weshalb er auch bisweilen repräsentative Institutionen befürwortet, ohne jedoch das Prinzip der Unabhängigkeit der Gemeinde je in Frage zu stellen.
Auf Bluntschlis «Statsrecht» aufbauend, findet man das Werk des Rechtshistorikers Otto von Gierke (1841-1921), der in vieler Hinsicht der geistige Nachfolger Bluntschlis ist. Bei Gierke ging die Vorstellung der Autonomie des lokalen Genossenschaftsverbandes gegenüber dem Gesamtstaat in Anlehnung an mittelalterliche Rechtsideen wieder erheblich weiter als bei Bluntschli.
Gierkes Ideen waren das letzte und noch einmal radikalisierte Aufbäumen einer Tradition, die von Althusius und später den Altrechtlern ausgegangen war. Durchaus sozialliberalen Kreisen nahestehend, meinte er dadurch, die Kritik am wirtschaftlichen Liberalismus abzufedern, indem er die soziale Dimension aus der zentralstaatlichen Sphäre, in die Bismarck sie nach 1881 eingebettet hatte, wieder in einer diversifizierten lokalen Gemeinschaftskultur verankern wollte. Diesen Gedanken vertiefte Gierke noch in seinem Buch «Die soziale Aufgabe des Privatrechts» von 1889, wo er seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass ein auf freiwilligen Körperschaften (Familie, Kirche und erst an letzter Stelle der Staat) aufbauendes Gemeinwesen den ansonsten notwendig bestehenden Gegensatz von Individual- und Kollektivinteressen entschärfe.
Gelungen ist dies nicht. Gierke fand keine Nachfolger mehr. Seine Idee, das Privatrecht in liberaler Weise zur Lösung der sozialen Probleme der Zeit zu nutzen, hat praktisch nur in der Begründung des modernen Arbeitsrechts (das ihn in seiner heutigen Form sicher schockiert hätte) irgendwelchen Niederschlag in der Rechtswissenschaft gefunden. An die Stelle der genossenschaftlichen Organisation lokaler Gewalten trat schnell das heute gültige Prinzip des hoheitlichen Souveränitätsbegriffs. Damit war auch das Projekt einer bodenständigen «deutschen Freiheitsidee» zum vorzeitigen Ende verurteilt.
Wie sie fortan zu definieren sei, das wurde nun von anderen bestimmt. Zu ihnen muss man vor allem den Historiker und Publizisten Heinrich von Treitschke (1834-1896) rechnen, der wohl der letzte wesentliche Autor war, der von «deutscher» oder «germanischer» Freiheit sprach. Obwohl er sich selbst als (national-) liberal definierte, war für ihn die Machtausweitung des Staates das primäre Ziel, die Freiheit allenfalls die Folge davon. Bedingungslos unterstützte er den Expansionismus Preussens und die deutsche Einigung durch «Blut und Eisen».
Nicht mehr die durch Konsens in Freiheit entstandene Bodenständigkeit, die ja das britische und deutsche Freiheitsverständnis als gemeinsames Freiheitserbe sah, sondern der schroffe Gegensatz zum angelsächsischen Individualismus standen im Mittelpunkt von Treitschkes Denken, wenn er von «deutscher Freiheit» schrieb. Alleine schon die Anglophobie — ein Ausfluss seines extremen Nationalismus — rechtfertigte für ihn den militarisierten und zentralisierten Staat. Das kommunitarische Beiwerk der spezifisch «deutschen Freiheit», das die Altrechtler dazu nutzen wollten, um die Freiheit nicht in einseitige Staatsabhängigkeit zu bringen, wurde von ihm zu einem Instrument der Staatstreue umfunktioniert und pervertiert.
Der Erste Weltkrieg, den dieses Denken vorzubereiten half, verschüttete die einstmals durchaus nicht unerhebliche Tradition des liberalen Föderalismus (4) und Non-Zentralismus vollends. Im Extremfall kam es zu den zentralistischen Exzessen, die man etwa in den Schriften Walter Rathenaus (der sich von der Kriegswirtschaft beeindrucken liess) findet, der meinte Staaten seien «die höchsten, allmächtigen Gebilde, die bestimmt sind, die Menschheitszweige unter dem Bilde der Willensorganisation darzustellen, die das Recht haben, jedes Hindernis, das einer reinen Willensentfaltung entgegensteht, niederzubrechen… Das Ziel aber ist der materiell unbeschränkte Staat.»
Die Liberalen haben sich mit ihrem Hang zum Zentralismus und mit der letztlichen Niederlage ihres durchaus bemerkenswerten non-zentralistischen Traditionsstrangs kaum einen Gefallen getan. Sie haben sich oft genug des Zentralismus bedient, um ihre Ziele — freier Markt und beschränkte Regierungsmacht — zu erreichen, nur um hinterher zu sehen, dass sie damit noch grössere Gefährdungen für eben diese Ziele geschaffen hatten. Das Ende des liberalen Lokalismus führte zu einem verantwor-
tungsloseren Politikverständnis — vor allem durch die Abkopplung von klarer Eigentumsverantwortung und Macht.
In der gegenwärtigen Zeit von Globalisierung und gleichzeitigem Staatsbankrott verwundert es nicht, dass es sowohl Ansätze in der Politik gibt, der zunehmenden Flexibilität der internationalen Wirtschaft mit Zentralisierungstendenzen (den Beginn einer Weltjustiz sehen wir bereits), aber eben auch mit Dezentralisierung zu begegnen. Mit Wilhelm Röpke (1899—1966) hat es immerhin einen einflussreichen deutschen Denker gegeben, der Non-Zentralisation als die der Marktwirtschaft und dem Freihandel angemessene Form politischer Organisation propagierte. Obwohl seine Forderung nach einer «genössischen» Gemeindeorganisation bisweilen ebenso sozialromantisch wie unklar formuliert blieb, hat Röpke mit seiner frühen und geradezu prophetischen Kritik am Europäischen Einigungsprozess entscheidende Elemente des klassischen liberalen Non-Zentralismus wiederbelebt. Dass dieser Prozess auf eine funktionale Ordnung zielen müsse, und nicht auf eine institutionelle, erscheint uns heute wie ein Nachhall der Theorien des Althusius, dass man Macht nur nach oben delegieren, ihr aber nie ein souveränes Mandat geben solle.
Der Wettbewerb zwischen den Staaten ist schon heute eine Realität, die den Druck auf die Politik selbst erhöht, sich in Richtung zu mehr Liberalisierung zu bewegen. Durch sie wird glücklicherweise ein Teil der Wirtschaftsprozesse aus dem staatlichen Wirkungsbereich herausgenommen. Ein Staat, der wirklich eine Wirtschaftspolitik zum Besten des Volkes betreiben will, muss mehr Wettbewerb und Marktöffnung zulassen. Internationaler Steuerwettbewerb schafft z.B. Anreize, die Steuern in einzelnen Ländern niedrig zu halten. Am besten werden diejenigen fahren, die auch politischen Wettbewerb innerhalb des eigenen Landes zulassen. In ausgesprochenen marktwirtschaftlichen Reformländern wie das einst erz-zentralistische Grossbritannien beginnen daher in letzter Zeit ernsthafte Dezentralisierungsversuche.
Ein libertäres Paradies wird daraus noch nicht entstehen. Dazu bedürfte es noch radikalerer Dezentralisierungsstrategien, für die es in Deutschland — im Gegensatz zu den USA – wenig Vorbilder gibt. Das sollte aber niemanden davon abhalten, den Weg zur Dezentralisierung zu beschreiten. Es kann schliesslich nur besser werden.
Anmerkungen:
(1) Althusius‘ Heimatstadt Emden war eine calvinistische Enklave im Deutschen Reich. Sie liess sich durch niederländische Truppen verteidigen, die eine feste Garnison dort etablierten. Dies ist ein schönes Beispiel für die Non-Zentralität des alten Reichs, das derartige Überlappungen der Hoheitsrechte problemlos zuliess.
(2) In der Tat gab es im Vormärz — wenn auch nicht so stark ausgebildet wie im Südwesten — in vielen Teilen Deutschlands eine liberale, lokalistische Tradition der Selbstverwaltung. In Preussen wären Stein und Hardenberg, in Kurhessen der Jurist Friedrich Murhard zu nennen.
(3) Deshalb benutzt Bluntschli an anderer Stelle auch den Begriff der «deutschen Freiheit».
(4) Von den sich liberal nennenden Mitgliedern der Weimarer Nationalversammlung war nur Wilhelm Heile (1881-1969) als offen bekennender und überzeugter Föderalist nennenswert.
Dr. phil. Detmar Doering ist stellvertretender Leiter des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung, Potsdam.
Tags:
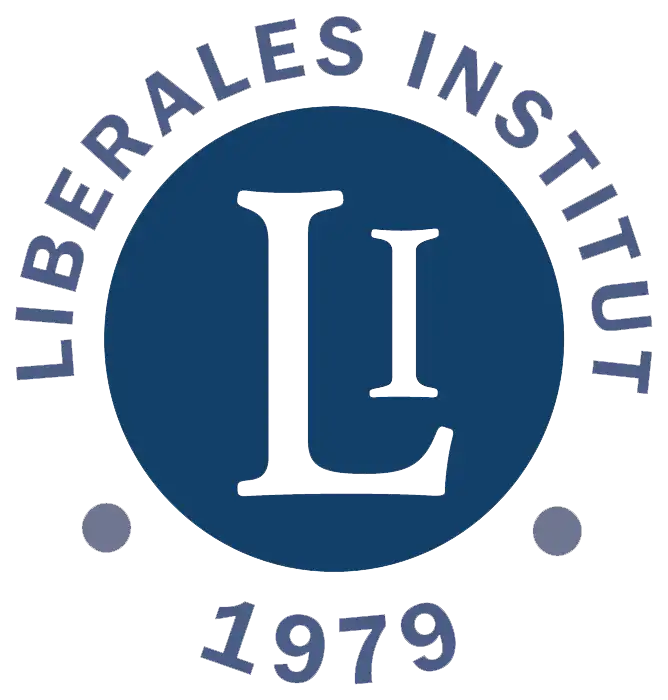
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.