
Was selbst vielen Ökonomen immer noch nicht bewusst ist: Wert ist etwas Subjektives. Mit Wert meinen wir natürlich nur den wirtschaftlichen Wert, nicht aber den moralischen, ästhetischen oder geistigen Wert von Dingen. Anders ausgedrückt behaupte ich, dass die Preise von Wirtschaftsgütern das Produkt der subjektiven Einschätzung von Menschen sind, die aufgrund von unterschiedlichen Faktoren – von physischen Bedürfnissen bis hin zu psychologischen oder kulturellen Einflüssen – die eine oder andere Präferenz haben. Aus ökonomischer Sicht ist es überflüssig, näher auf diese Faktoren einzugehen. Was wir uns aber vor Augen halten müssen, ist die Tatsache, dass die Verbraucher, die ganz normale Leute sind, den wirtschaftlichen Wert (sprich den Preis) von Dingen anhand ihrer persönlichen Vorlieben bestimmen.
Einige Wirtschaftstheorien gingen davon aus, dass der Wert etwas Objektives sei, das heisst, dass er sich aus quantifizierbaren Einheiten ableitet, die während der Produktion Teil der Handelsware wurden. Die marxistische Lehre zum Beispiel sah den Arbeitsaufwand für ein bestimmtes Gut als objektiven Ursprung von dessen Wert an. Ihr zufolge ist ein Diamant mehr wert als ein Liter Wasser, auch wenn das Wasser absolut gesehen nützlicher ist als der Edelstein, der aber viel aufwendiger gewonnen und verarbeitet werden muss. Wäre dem aber tatsächlich so, könnte ein echter van Gogh niemals teurer sein als ein Diamant oder ein Flugzeug, denn in der Gewinnung und Verarbeitung von Diamanten beziehungsweise der Herstellung eines Flugzeugs stecken viel mehr Arbeitsstunden und Materialien als dies auf ein Gemälde zutrifft.
Jetzt könnte aber der Einwand kommen, dass ein Bild ein Unikat ist und allein schon deshalb teurer sein muss. Was aber, wenn ein unbekannter Künstler ein Gemälde malt? Dann kann es passieren, dass niemand auch nur einen Cent dafür ausgeben will. Mal angenommen, ein begabter Maler kopiert ein Gemälde von van Gogh, verwendet die gleichen Farben und braucht dafür genauso lange. Wäre der wirtschaftliche Wert eine objektive Grösse und setzte sich aus den Arbeitsstunden plus den verwendeten Ressourcen zusammen, sollten doch Kopie und Original den gleichen Preis erzielen, oder? Doch die Realität sieht anders aus. Für die Kopie erhielte der namenlose Künstler nur einen Bruchteil dessen, was für das Original ausgegeben wird. Weshalb ist das so? Weil der Wert von etwas in unseren Köpfen festgelegt wird und daher eine subjektive, aber keine objektive Grösse ist.
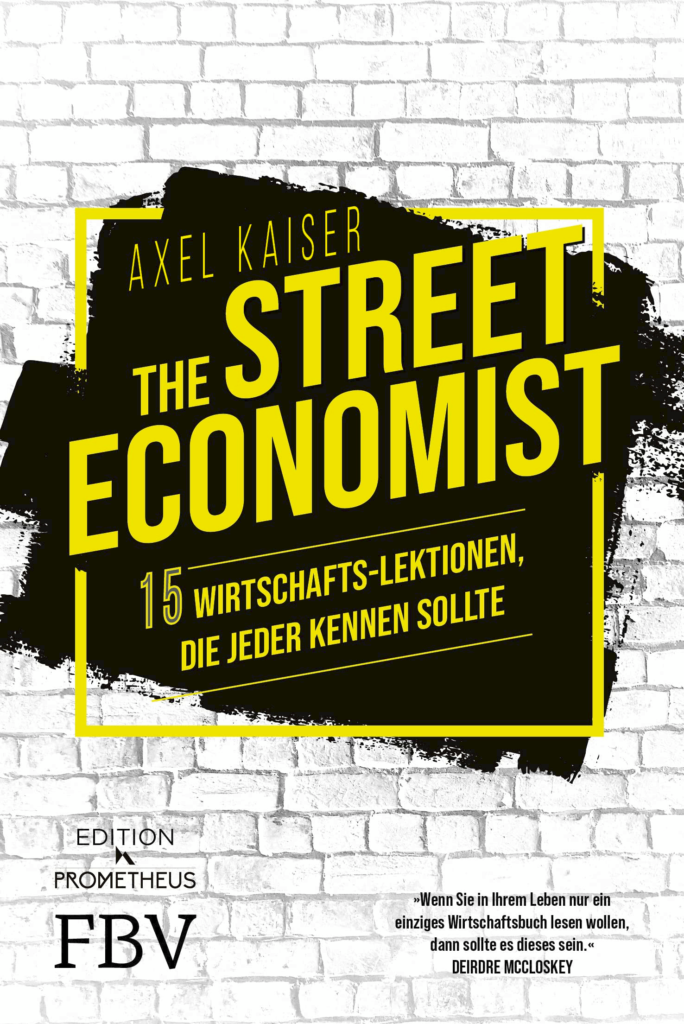 Anders ausgedrückt sind Dinge nur deshalb wertvoll, weil wir sie haben wollen. So einfach ist das. Es gibt keinen stichhaltigen objektiven Grund, weshalb ein Gemälde von van Gogh über 100 Millionen US-Dollar kostet. In dem Bild steckt nichts, was eine derart hohe Summe rechtfertigen würde. Eigentlich. So ähnlich verhält es sich auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Schweinefleisch. In der Schweiz wird für Bioschweinefleisch ein relativ hoher Preis gezahlt, doch in muslimischen Ländern ist es keinen Pfifferling wert, da dort der Konsum von Schweinefleisch aus religiösen Gründen nicht gestattet ist. Da spielt es auch keine Rolle, wie viele Arbeitsstunden in der Aufzucht der Schweine stecken, ihr Marktwert ist gleich null. Ein Lamm hingegen, auch wenn dessen Aufzucht weniger aufwendig ist, besitzt einen höheren Wert, da sein Fleisch in der arabischen Welt am beliebtesten ist.
Anders ausgedrückt sind Dinge nur deshalb wertvoll, weil wir sie haben wollen. So einfach ist das. Es gibt keinen stichhaltigen objektiven Grund, weshalb ein Gemälde von van Gogh über 100 Millionen US-Dollar kostet. In dem Bild steckt nichts, was eine derart hohe Summe rechtfertigen würde. Eigentlich. So ähnlich verhält es sich auch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Schweinefleisch. In der Schweiz wird für Bioschweinefleisch ein relativ hoher Preis gezahlt, doch in muslimischen Ländern ist es keinen Pfifferling wert, da dort der Konsum von Schweinefleisch aus religiösen Gründen nicht gestattet ist. Da spielt es auch keine Rolle, wie viele Arbeitsstunden in der Aufzucht der Schweine stecken, ihr Marktwert ist gleich null. Ein Lamm hingegen, auch wenn dessen Aufzucht weniger aufwendig ist, besitzt einen höheren Wert, da sein Fleisch in der arabischen Welt am beliebtesten ist.
Wir kommen also zu dem Schluss, dass sich der Preis, also der wirtschaftliche Wert von Produkten, ausschliesslich nach deren Nachfrage – und Angebot – richtet. Ebenso werden die Produktionskosten aller Waren durch die Nachfrage nach deren Produktionsfaktoren bestimmt, die sich wiederum aus den subjektiven Vorlieben und Bedürfnissen ergibt, die letzten Endes festlegen, was produziert wird. Anders ausgedrückt, Kakao besitzt einen bestimmten Wert, weil Schokolade stark nachgefragt wird. Würde niemand Schokolade essen, wäre der Kakaopreis gleich null oder nahe dran.
Lassen Sie mich diesen Punkt an einem weiteren Beispiel verdeutlichen: Mal angenommen, es wird bekannt, dass in einem Bankschliessfach Schmuck im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar liegt. Es gibt nur einen einzigen passenden Schlüssel, der aber nicht nachgemacht werden kann und der 50 US-Dollar kostet. Wie viel glauben Sie, wären die Leute auf einer Auktion bereit, für diesen Schlüssel auszugeben? 1.000 US-Dollar? 1 Million US-Dollar? 99.990.000 US-Dollar? Alles ist denkbar. Der Wert dieses Schlüssels wird also weder durch den bei der Herstellung anfallenden Arbeitsaufwand noch durch die Material- und sonstigen Produktionskosten bestimmt, sondern einzig und allein dadurch, dass jemand den Schlüssel und damit den Schmuck haben will.
Der Schlüssel besitzt diesen einzigartigen Wert nur, weil er extrem nützlich für seinen künftigen Besitzer ist. Doch auch dieser Nutzen ist von subjektiver Bedeutung, denn es könnte durchaus sein, dass jemand wie zum Beispiel ein buddhistischer Mönch kein Interesse an den Juwelen hat. Fände die Auktion in einem buddhistischen Kloster statt, könnte es gut und gerne sein, dass sich dort kein Abnehmer für den Schlüssel findet. In diesem Fall wäre der Wert dieses Schlüssels gleich null, da er für die Mönche keinerlei Nutzen hat.
Was ist eine Flasche Wasser wert? Für einen Verdurstenden in der Wüste dürfte der Wert ziemlich hoch sein, aber das ist natürlich nicht absolut, sondern relativ gesehen. Hat der Verdurstende die Wahl zwischen Wasser und einem Diamanten, wird er sich wohl für das Wasser entscheiden und mehr dafür zahlen, auch wenn die Produktionskosten von Wasser viel niedriger sind als die von Diamanten. Gibt es jedoch alle 100 Meter einen Stand, an dem er Wasser kaufen kann, wird er sich, nachdem er sich einen Wasservorrat angelegt hat, für den Diamanten entscheiden und wiederum dafür mehr zahlen. Diese Veränderung des Wertes (des Preises) wird von Wirtschaftswissenschaftlern als »abnehmender Grenznutzen« bezeichnet. Anders ausgedrückt nimmt die Grösse ein und desselben Genusses fortwährend ab, wenn wir mit der Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, bis zuletzt Sättigung eintritt. Soll heissen, wir sind nicht bereit, für etwas, was wir des Öfteren haben wollen, andauernd den gleichen Preis zu zahlen.
Wir müssen also festhalten, dass sich der wirtschaftliche Wert nicht aus dem absoluten Nutzen einer Sache, sondern aus einer bestimmten Einheit dieser Sache abhängig vom Kontext ableitet. Anders ausgedrückt würde die Grundlage für den Wert oder Preis von Wasser anders sein, wenn Wasser überall auf der Welt knapp wäre, denn die jeweiligen Umstände und der Kontext bedingen seinen Wert. So wäre sein Wert in der Nähe eines Flusses gleich null, in der Wüste dagegen sehr hoch, doch selbst dort kann es an Wert verlieren, wenn es zum Beispiel durch heftige Regenfälle viel Wasser gibt. Der Wert ist also eine Funktion des subjektiven Nutzens einer Sache und ihrer im Verlauf der Zeit auftretenden Verknappung.
Luft ist ebenso nützlich wie Wasser, aber sie ist alles andere als ein knappes Gut und besitzt daher keinen wirtschaftlichen Wert. Der Wert von Wasser und Diamanten ist jedoch unter bestimmten Umständen und abhängig von der individuellen Nachfrage nahezu austauschbar. Schliesslich ergibt sich der Wert, und damit der Preis, aus einer Mischung aus Nutzen und Knappheit. Es gibt zahllose nützliche Dinge, die aber im Überfluss vorhanden sind und daher keinen wirtschaftlichen Wert haben, wie zum Beispiel Luft, und es gibt knappe nutzlose Dinge, die keinerlei Wert besitzen, wie ein totes Tier am Strassenrand oder ein wackliger Tisch mit fünf Beinen.
Eines ist jedoch sonnenklar: In der Praxis ist es so, dass die Wertschätzung eines Produkts seinen Preis bestimmt und auch den der Fertigungskosten und nicht etwa umgekehrt. Bei einem Sterne-Menü bestimmen weniger die Kosten der Zutaten den im Restaurant verlangten Preis, sondern die Bekanntheit des Kochs. Die Nachfrage nach seiner Kochkunst bestimmt sowohl den Preis, den er bei seinen Lieferanten zahlen muss, als auch die Summe, die seine Gäste auf den Tisch legen müssen. Je mehr sie für sein Pilzgericht zu zahlen bereit sind, umso höher wird der Wert dieser Pilze, denn umso öfter werden sie verlangt. All das ist also in höchstem Masse subjektiv, denn im Prinzip kostet die Zubereitung des Gerichts immer annähernd gleich viel, ausser es stehen neue effizientere Technologien zur Verfügung.
Die Vorstellung, dass der Wert von Sachen eine subjektive Angelegenheit ist, stellte – auch wenn sie nicht wirklich kompliziert ist – die wirtschaftliche Denkweise auf den Kopf. Doch nur so lässt sich nachvollziehen, weshalb eine freie Wirtschaft die einzige Wirtschaftsform ist, die wahren Fortschritt hervorbringen kann.
Die irrige Vorstellung vom objektiven wirtschaftlichen Wert hingegen legte den Grundstein für die abträgliche Theorie von der kapitalistischen Ausbeutung. Wie bereits angedeutet, hing für Marx – und fast alle Anhänger der klassischen Ökonomie – der Tauschwert einer Ware von den für ihre Fertigung benötigten Arbeitsstunden ab. Der einzige Grund, weshalb ein Auto mehr wert war als ein Bleistift, war den Marxisten zufolge die Tatsache, dass Ersteres viel aufwendiger in der Herstellung war. Das für die Produktion von Bleistiften benötigte Grafit und Holz konnten gegen den Stahl und andere für die Fertigung eines Fahrzeugs benötigten Materialien eingetauscht werden, allerdings in unterschiedlichen Mengen. So könnte zum Beispiel je eine Tonne Holz und Grafit gegen eine halbe Tonne Stahl und sonstiges Material eingetauscht werden.
Uns stellt sich die Frage: Worauf basiert dieses Tauschverhältnis und was ist die Gemeinsamkeit dieser Waren? Die Arbeit, so Marx. Wenn 500 Kilogramm Holz und Grafit nur halb so viel kosten wie eine Tonne Stahl und andere Materialien, dann deshalb, weil in ihrer Herstellung nur halb so viele Arbeitsstunden stecken. Wenn das Auto also tausendmal so viel kostet wie der Bleistift, dann deshalb, weil die Fertigung, sagen wir mal, tausend Arbeitsstunden verschlingt, während der Bleistift in nur einer Stunde hergestellt werden kann. Der Tauschwert ergibt sich also aus den Arbeitsstunden.
Dann führen wir diese Gedanken doch einmal fort: Wenn Arbeit das ist, was den Wert sämtlicher Handelswaren ausmacht und wenn der Kapitalist den Arbeitern einen Lohn zahlt, der dem von ihnen geschaffenen Wert komplett entspricht, hätte Ersterer nichts davon, da er keinen Profit erwirtschaftet. Mal angenommen, er verkauft die Ware für 10, dann entspricht diese 10 dem von einem Arbeiter geschaffenen Wert. Der Kapitalist erzielt folglich keinen Gewinn, wenn er dem Werktätigen 10 bezahlt. Fakt ist aber, dass Profit gemacht wurde, was einer Erklärung bedarf. Marx zufolge verkaufen die Arbeiter ihre Arbeitskraft im Tausch gegen Geld. So gesehen ist Arbeit eine Tauschware, deren Menge so begrenzt ist wie die von Eisen, Weizen, Zement oder jeder anderen x-beliebigen Ware auf dem Markt. So wie die Menge des im Handel erhältlichen Stahls von der Anzahl der zu dessen Herstellung eingesetzten Arbeitsstunden abhängt, hängt die Menge der zur Verfügung stehenden Ware namens Arbeitskraft zugleich davon ab, wie viel Arbeit nötig ist, um diese zu erhalten.
Jeder Arbeiter braucht zur Erhaltung seiner Arbeitskraft Lebensmittel, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und viele andere Dinge, die er von seinem Lohn bezahlt.
Das bedeutet, dass jede Arbeitsstunde einen Wert für den Kapitalisten schafft, aber auch Kosten für den Arbeiter, da dieser Geld für Lebensmittel, Kleidung und sonstige, dem Erhalt seiner Arbeitskraft dienenden Mittel ausgeben muss. Nehmen wir nun an, dass der Kapitalist die Arbeit seines Angestellten für 10 verkauft, kann er nur dann Gewinn erzielen, wenn der Lohn des Arbeiters geringer ist als der von ihm erzeugte Wert. Denkbar wäre zum Beispiel 7. Doch wenn der Arbeiter einen Wert von 10 erschafft und dies dem Faktor entspricht, der nötig ist, um seine Arbeitskraft zu erhalten, dann kann Marx zufolge der Kapitalist nur dann Profit erwirtschaften, wenn er dem Arbeiter weniger als den Wert dessen bezahlt, was er produziert, das heisst weniger als die Kosten, die dem Arbeiter entstehen, um seine Arbeitskraft zu erhalten.
Anders ausgedrückt leisten die Arbeiter Arbeitsstunden und schaffen dadurch einen Mehrwert, wofür sie aber keine Vergütung erhalten. Das bedeutet, der Arbeitgeber entzieht dem Arbeitnehmer Mehrwert. So gesehen steht der Arbeiter also schlechter da als ohne Arbeit, da ihm Kosten für den Erhalt seiner Arbeitskraft entstehen, auf denen er sitzen bleibt. Gewinn ist also nichts anderes als das Produkt von Ausbeutung und Marx zufolge geht der gesamte Wohlstand einer Gesellschaft letzten Endes auf die Arbeiter zurück, niemals aber auf innovative Erfindungen oder Kapitalbesitzer.
Zugleich werden Kapitalisten, so Marx, versuchen, die Produktion mithilfe von Anlagekapital (wie Maschinen) und damit auch die Gewinne zu steigern, während sie gleichzeitig die Kosten zu reduzieren versuchen. Deshalb kommt es dann zu Entlassungen von Arbeitern. Da sämtliche Kapitalisten am gleichen Strang ziehen, kommt es zu einem heftigen Gerangel, um Kapital zu akkumulieren, um noch mehr Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, die Produktion weiter zu erhöhen und folglich noch mehr Gewinne erwirtschaften zu können. Da Marx aber überzeugt ist, nur Arbeit erzeuge Wert, sinken die Gewinne in dem Masse, wie immer mehr Kapital angehäuft wird. Da aber Profit erzeugt werden muss, zugleich aber immer weniger davon erwirtschaftet werden kann, nimmt die Ausbeutung der wenigen noch übrig gebliebenen Arbeiter stetig zu und treibt sie letzten Endes ins Elend.
Hier liegt Marx zufolge die grösste Widersprüchlichkeit des Kapitalismus: Das Streben nach immer höheren Gewinnen, indem Arbeit durch Kapital ersetzt wird, führt letzten Endes zu einer Verelendung des Proletariats. So gesehen wird es seiner Meinung nach eine Armee verarmter Arbeiter geben, die dann die sozialistische Revolution entfesseln werden, in dem sie sich die Enteignung der Produktionsmittel auf die Fahne schreiben.
Wie bekannt ist, erwies sich diese Prognose als völlig unzutreffend. In Ländern, die am meisten Kapital angesammelt hatten, stieg das Einkommen der Ärmsten, bis sie nicht mehr unvermögend waren, sondern dem wohlhabenden Bürgertum zugerechnet werden konnten. Und in keinem dieser Länder kam es zu einer sozialistischen Revolution. Ganz anders dagegen war es in armen Ländern ohne grössere kapitalistische Entwicklung wie China oder Russland.
Der marxistischen Sichtweise zufolge sind Profit, Kapital, Innovation und Wettbewerb – also die grundlegenden Dinge für sozialen Fortschritt – Ursachen von Unterdrückung und Elend. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass Marx und alle antikapitalistischen Schulen, die nach ihm kamen, nicht einmal die elementarsten Prinzipien der Ökonomie verstanden haben, weshalb die Umsetzung ihrer Ideen zu Totalitarismus und Armut in grossem Masse führte.
Hätten Marx und andere klassische Ökonomen etwas so Simples verstanden wie die Vorstellung, dass Wert etwas Subjektives ist, hätte es den Kommunismus nie gegeben, denn dessen gesamtes theoretisches Gerüst beruhte auf einem intellektuellen Irrtum, nämlich der Theorie vom objektiven Wert der Güter, bei der die Unternehmensgewinne die logische Folge von Ausbeutung sind.
Auch wenn man die Wirtschaftswissenschaftler, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen und noch immer an die Theorie vom objektiven Wert glauben, an einer Hand abzählen kann, ist die Überzeugung, dass Unternehmer ihre Profite auf Kosten der Arbeitnehmer machen, nach wie vor weit verbreitet. Nicht anders als die Marxisten sind viele Bürger, Politiker, Intellektuelle, Künstler und andere davon überzeugt, Arbeitgeber beuteten die Arbeitnehmer aus, indem sie aus deren Arbeit Gewinn abschöpfen. Diese Ansicht ist aber von Grund auf falsch, denn da Wert subjektiv ist, werden die Löhne nicht vom Arbeitgeber, sondern von den Verbrauchern bezahlt, die grösstenteils selbst Arbeitnehmer sind.
Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus dem Buch The Street Economist – 15 Wirtschafts-Lektionen, die jeder kennen sollte von Axel Kaiser. Erschienen 2023 bei FBV.

LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.