
Ökoaktivisten richten sich mit immer radikaleren Forderungen an die Politik. Schuld an Umweltschäden sei das profitorientierte Wirtschaftssystem. Die freie Marktwirtschaft müsse deshalb durch ein System mit umfangreichen staatlichen Kontrollen, Eingriffen und Verboten ersetzt werden. Doch gibt es in der Wissenschaft tatsächlich Hinweise darauf, dass ein Mehr an staatlicher Planung, Regulierung und Intervention zu einem besseren Umweltschutz führt? Unter welchen Bedingungen entstehen ressourcenschonende Innovationen? Was für einen Beitrag zum Umweltschutz können freie Märkte, das Unternehmertum und ein geschütztes Privateigentum leisten? Im Rahmen der LI-Konferenz vom 29. Oktober wurden diese Fragestellungen vertieft diskutiert. Zugleich wurde das neue Buch der Edition Liberales Institut mit dem Titel «Mutter Natur und Vater Staat: Freiheitliche Wege aus der Beziehungskrise» vorgestellt.
Einführend stellte LI-Direktor Olivier Kessler fest, dass die Forderung der Klimademonstranten, sich vereint hinter «die Wissenschaft» zu stellen oder einer Mehrheit der Wissenschaftler zu folgen, ein denkbar unwissenschaftlicher Ansatz sei, weil sich in der Vergangenheit Mehrheiten oft geirrt hätten. Karl R. Popper (1902-1994) habe im sogenannten Methodenstreit die Auffassung vertreten, dass eine Hypothese falsifizierbar sein müsse, damit sie als wissenschaftlich bezeichnet werden könne. Dies gelte zwar weniger für die Sozialwissenschaften, wo kaum kontrollierte Experimente durchgeführt werden könnten, dafür aber umso mehr für die Naturwissenschaften. Nur Theorien, die viele Falsifizierungsversuche überstünden, bewährten sich nach Popper und brächten die Menschheit näher an den Kern der Wahrheit heran. Dieses Kriterium trenne scharf Wissenschaft von Ideologie, denn eine Ideologie besitze grenzenlose Anpassungsfähigkeit.
In der aktuellen Diskussion um die Klimaerwärmung würden keine konkreten Wetterwerte wie beispielsweise die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an konkreten Orten genannt, die die Theorien als falsch erweisen würden, wenn sie denn beobachtet würden. Stattdessen spreche angeblich jeder beliebige Wettertrend und jedes Extremwetterereignis für die Richtigkeit der Hypothesen, aus welchen dann politische Extremmassnahmen abgeleitet werden. Dies deute darauf hin, dass es sich nicht um wissenschaftliche, sondern um ideologische Aussagen handeln könnte.
In seinem Referat betonte Matthias Müller, Jurist, Doktorand und Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, die Vereinbarkeit von Marktwirtschaft und Umweltschutz. Dies zeige sich einerseits empirisch: Ein weltweiter Vergleich aller Länder offenbare, dass tendenziell marktwirtschaftliche Länder den unfreien Ländern punkto Umweltqualität um Längen voraus seien. Letztere gehörten aufgrund ihrer ineffizienten Produktionsweisen und der entsprechenden Ressourcenverschwendung zu den grössten Umweltsündern. Doch auch aus theoretischen Überlegungen seien diese Befunde keine Überraschung. Denn zu den Kernpfeilern eines liberalen Systems gehörten der Schutz des Privateigentums, die Vertragsfreiheit und die Rechtsstaatlichkeit. Diese Institutionen stellten — sofern sie denn konsequent durchgesetzt würden — sicher, dass der Einzelne einerseits für die von ihm verursachten Umweltschäden zur Verantwortung gezogen werden und er andererseits ihm geeignete Massnahmen für den Schutz der Umwelt ergreifen könne, ohne zunächst auf den behördlichen Segen warten zu müssen.
Umweltschutz sei nicht etwas, was man den privaten Akteuren von oben herab verordnen müsse. Dies werde durch die Tatsache verdeutlicht, dass die meisten Unternehmen aus freien Stücken Nachhaltigkeits-Strategien und -Projekte verfolgen würden, weil ein nicht unbedeutender Teil der Kundschaft es so verlange. Insofern könne ein besonders nachhaltiges Wirtschaften durchaus zum Wettbewerbsvorteil gereichen und die Gewinne des Unternehmens erhöhen. Staatlicher Dirigismus sei im Bereich des Umweltschutzes hingegen klar abzulehnen, weil dieser nicht nur die erfolgserprobten Grundlagen des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes untergrabe, sondern auch die Türen für eine allgemeinwohlschädliche Sonderinteressen-Politik öffne. Viel zu oft würden dann unter dem Vorwand des Umweltschutzes lediglich industriepolitische und ideologische Ziele verfolgt.
Henrique Schneider, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft, hat selbst an Klimakonferenzen teilgenommen. Die Behauptung, alle Länder müssten nun aufgrund des Übereinkommens von Paris aus dem Jahr 2015 eine CO2-Steuer einführen oder eine Flugticketabgabe beschliessen, sind Schneider zufolge falsch. Vielmehr erlaube das Abkommen den einzelnen Ländern, ihren eigenen Weg zu gehen und das sei auch richtig so. Denn dezentrale Ansätze führten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Erfolg als zentralistisch verordnete Einheitsvorgaben. Warum? Weil Dezentralität unterschiedliche Zielsetzungen, Lösungen, Mittel und Verfahren erlaubten, die den jeweiligen Regionen, Kulturen und Bedürfnissen angepasst seien. Umweltschutzinnovationen könnten nur dann entstehen, wenn man Individuen, Unternehmen und Ländern die Möglichkeit liesse, etwas anders zu machen als die anderen. Die Vielfalt im Wettbewerb sei daher ein wichtiger Kapitalstock.
Es gäbe bereits eine Reihe vielversprechender Technologien, die uns dabei helfen könnten, mit dem Klimawandel umzugehen. Schneider nannte etwa die Kernkraft, mit der relativ CO2-arme Energie gewonnen werden könne, die «Carbon Capture and Storage»-Technologie, mit welcher CO2 aus der Atmosphäre genommen und gespeichert werden könne, und die Genfood-Technologie, dank welcher die Landwirtschaft weniger bodenintensiv würde (ein Grossteil des CO2 kommt aus dem Boden). Das Problem mit diesen Technologien ist, dass sie nicht an allen Orten der Welt unumstritten seien und nicht im globalen Rahmen durch Klimakonventionen von oben herab verordnet werden könnten. Mit einem dezentralen Ansatz hingegen könne man solche Technologien ausprobieren und ihren Nutzen testen. Falls diese keine Vorteile brächten, hätte niemand ein Interesse daran, die entsprechenden Investitionen weiterzuführen, und sie könnten problemlos wieder aufgegeben werden. Falls sie jedoch von Erfolg gekrönt seien, könnten sie sich in immer breiterem Massstab durch Nachahmung durch andere durchsetzen.
Carlos A. Gebauer, Rechtsanwalt und Publizist, beleuchtete die machtpolitischen Implikationen des Öko-Interventionismus und zog Parallelen zur römisch-katholischen Kirche im Mittelalter: Auch damals schon sei es darum gegangen, die Menschen hierarchisch unterzuordnen und fremdzubestimmen, indem eine theologische Informationsasymmetrie aufrechterhalten worden sei. Menschen sollten die Bibel nicht selbst lesen und interpretieren, sondern sich an Experten — Priester, Pfarrer — wenden, die sie für sie übersetzten und interpretierten. Die Reformation und die Aufklärung hätten dem ein Ende gesetzt und die Menschheit von der Fremdbestimmung und religiöser Bevormundung befreit. Aktuell könne jedoch wieder eine Rückkehr zur Verhaltenssteuerung durch Herrscher beobachtet werden, indem eine ökologische Informationsasymmetrie geschaffen wurde und Experten uns erklärten, wie wir uns zu verhalten hätten, um keine strafenden Götter zu provozieren, die Naturkatastrophen über uns bringen würden.
Aus herrschaftspolitischen Überlegungen sei jedoch die Panikmache vor dem Klimawandel zwecks Ausweitung und Zentralisierung politischer Kompetenzen nicht ideal, weil der Untergang von Inseln in 100 Jahren zu weit weg sei und daher an Schreckenspotenzial einbüssten. Die aktuelle Corona-Krise hole die Bedrohung jedoch unmittelbar in die Gegenwart. Die Eigenverantwortung der Menschen werde geopfert und die Fremdbestimmung durch Experten — Virologen, Infektiologen, Epidemiologen — habe wieder die Oberhand gewonnen. So wie man früher in die Kirche gegangen sei, um Konformität zu demonstrieren, trage man heute — als Symbol der Unterwerfung — eine Maske. Das machtpolitische Mittelalter sei zurück.
Die darauffolgende Diskussion widmete sich unter anderem der Frage, welche konkreten Beispiele für Umweltschutz es im Kapitalismus gebe. Nachdem betont wurde, dass die meisten Umweltschäden im heutigen System gerade nicht den kapitalistischen, sondern den öko-interventionistischen oder öko-sozialistischen Elementen wie Technologieverboten und den Nebeneffekten von Regulierungen angelastet werden müssen, ging man dazu über, wie der Kapitalismus konkret die Umwelt schütze.
Dank marktwirtschaftlichem Wettbewerb entstünden einerseits immer neue umweltschonende Technologien. Andererseits mache es auch aus reiner Gewinnmaximierungs-Logik Sinn, mehr Ressourcen in der Produktion einzusparen als die Konkurrenz, weil dadurch Ausgaben wegfielen und die Gewinne gesteigert werden könnten. Ein gutes Beispiel für eine marktwirtschaftliche Innovation sei das Smartphone, dank welchem heute diverse materialintensive Produkte wie Telefonkabinen, Fotoapparate, Videokameras, Taschenlampen, Telefonbücher und Zeitungen nicht mehr oder zumindest nicht im gleichen Umfang hergestellt werden müssten. Dies schone natürliche Ressourcen, ohne auf eine Erhöhung der Lebensstandards verzichten zu müssen. Viele weitere Beispiele werden im neuen LI-Buch «Mutter Natur und Vater Staat: Freiheitliche Wege aus der Beziehungskrise» präsentiert.
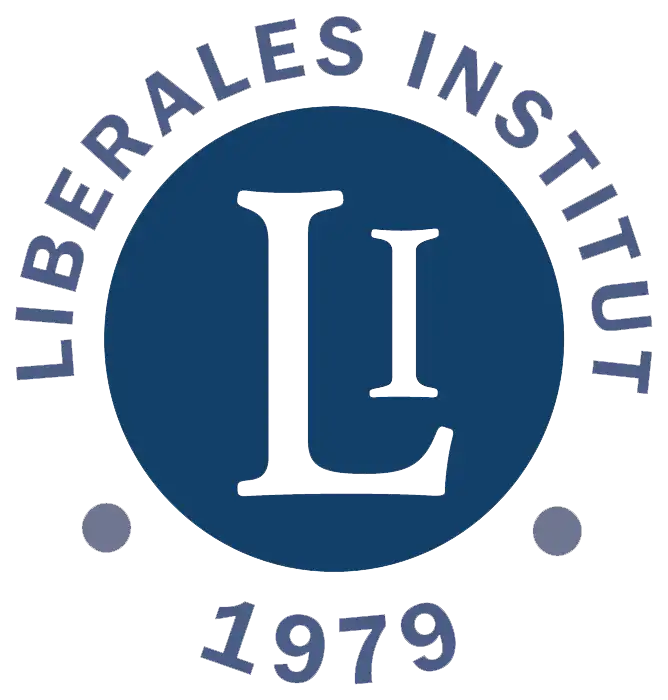
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.