
Heute werden mit Verweis auf Aussagen von Forschern und Studien oftmals Sachzwänge behauptet, die ein bestimmtes Eingreifen des Staates als «alternativlos» erscheinen lassen. Wer die behaupteten Sachzwänge bezweifelt, wird oft als «Wissenschaftsleugner» abgestempelt und aus der öffentlichen Debatte «gecancelt». Wer sich gegen diese wissenschaftlich vermeintlich bewiesene Notwendigkeit stelle, handle verantwortungslos. Solchen Kritikern dürfe man keinesfalls auch noch eine Plattform bieten. Soziale Medien sind deshalb bestrebt, Beiträge, die «wissenschaftlichen Befunden» widersprechen, umgehend zu löschen oder sie zumindest mit «Fake News»-Warnhinweisen zu versehen. Das Hinterfragen, Anzweifeln und Erheben von Widerspruch erscheint aus dieser Perspektive, wonach wissenschaftlich angeblich alles Relevante geklärt sei, nur als lästig.
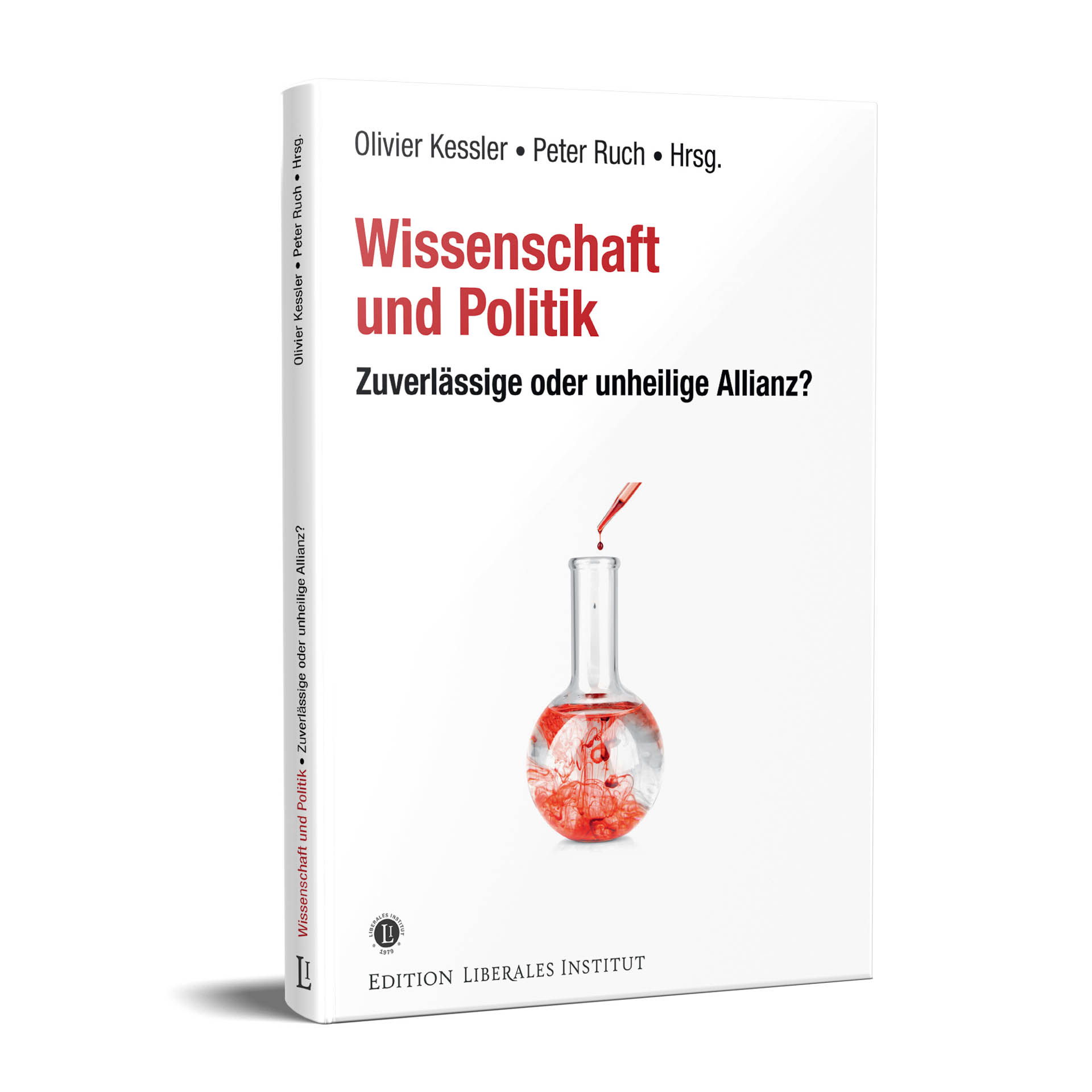 Doch wer oder was ist «die Wissenschaft» überhaupt? Wer entscheidet, welche der vielen Studien nun Gewicht im öffentlichen Diskurs erhalten, welche Fachdisziplinen für eine konkrete Fragestellung als relevant erachtet werden und welche Methode die geeignete ist? Wer wählt die sogenannten «Experten» aus, die Sachzwänge behaupten und der Politik «wissenschaftliche» Handlungsanweisungen erteilen? Kann die Wissenschaft überhaupt verbindliche Vorgaben machen, wie die Politik oder der Einzelne auf bestimmte Phänomene reagieren muss? Das sind Fragen, die in der öffentlichen Debatte viel zu wenig diskutiert und beleuchtet werden. Dies wollen die Autoren eines neuen Sammelbands des LI ändern. Das Buch «Wissenschaft und Politik: Zuverlässige oder unheilige Allianz?» wurde daher an der LI-Konferenz vom 25. Oktober 2022 vorgestellt — mit dem Ziel, eine breite Debatte zu diesem wichtigen Thema zu lancieren.
Doch wer oder was ist «die Wissenschaft» überhaupt? Wer entscheidet, welche der vielen Studien nun Gewicht im öffentlichen Diskurs erhalten, welche Fachdisziplinen für eine konkrete Fragestellung als relevant erachtet werden und welche Methode die geeignete ist? Wer wählt die sogenannten «Experten» aus, die Sachzwänge behaupten und der Politik «wissenschaftliche» Handlungsanweisungen erteilen? Kann die Wissenschaft überhaupt verbindliche Vorgaben machen, wie die Politik oder der Einzelne auf bestimmte Phänomene reagieren muss? Das sind Fragen, die in der öffentlichen Debatte viel zu wenig diskutiert und beleuchtet werden. Dies wollen die Autoren eines neuen Sammelbands des LI ändern. Das Buch «Wissenschaft und Politik: Zuverlässige oder unheilige Allianz?» wurde daher an der LI-Konferenz vom 25. Oktober 2022 vorgestellt — mit dem Ziel, eine breite Debatte zu diesem wichtigen Thema zu lancieren.
 Einführend betonte LI-Direktor Olivier Kessler, dass die Instrumentalisierung der Wissenschaft für politische Zwecke eine Gefahr für liberale Gesellschaften sei. Der Einzelne werde mit Hinweis auf «wissenschaftliche Erkenntnisse» bis ins Kleinste kontrolliert und verwaltet, so als ob «die Wissenschaft» ein für alle Mal festlegen könne, was als sakrosankt zu gelten habe und nicht mehr hinterfragt werden dürfe. Ein solches Verständnis habe mit der ursprünglichen Bedeutung von Wissenschaft nicht mehr viel zu tun: «Wissenschaft» werde so zu einer quasireligiösen Autorität erhoben, anstatt sie als eine unkorrumpierbare Methode und einen unbestechlichen Prozess zur Annäherung an die Wahrheit zu sehen. Die Verfechter eines derartigen Wissenschaftsverständnisses plädierten für einen neuen Imperativ, der laute: «Glaubt der Wissenschaft!» — ohne die Absurdität dieser Forderung zu erkennen.
Einführend betonte LI-Direktor Olivier Kessler, dass die Instrumentalisierung der Wissenschaft für politische Zwecke eine Gefahr für liberale Gesellschaften sei. Der Einzelne werde mit Hinweis auf «wissenschaftliche Erkenntnisse» bis ins Kleinste kontrolliert und verwaltet, so als ob «die Wissenschaft» ein für alle Mal festlegen könne, was als sakrosankt zu gelten habe und nicht mehr hinterfragt werden dürfe. Ein solches Verständnis habe mit der ursprünglichen Bedeutung von Wissenschaft nicht mehr viel zu tun: «Wissenschaft» werde so zu einer quasireligiösen Autorität erhoben, anstatt sie als eine unkorrumpierbare Methode und einen unbestechlichen Prozess zur Annäherung an die Wahrheit zu sehen. Die Verfechter eines derartigen Wissenschaftsverständnisses plädierten für einen neuen Imperativ, der laute: «Glaubt der Wissenschaft!» — ohne die Absurdität dieser Forderung zu erkennen.
Der Philosoph Karl R. Popper habe argumentiert, Wissenschaft setze nicht unhinterfragbare Glaubenssätze, sondern Thesen voraus, die falsifiziert werden könnten. Wissenschaft basiere demnach auf einem Wettbewerb der Ideen und widerstreitenden Theorien, die sich bewähren müssten. Die Forderung, der Einzelne oder die Politik habe sich zwingend bestimmten «wissenschaftlichen Erkenntnissen» zu unterwerfen und unkritisch zu akzeptieren, sei also weder wissenschaftlich, noch mit dem Pluralismus einer offenen Gesellschaft vereinbar. Natürlich sollten Meinungen von Experten möglichst vorurteilsfrei angehört werden. Selbstverständlich sollten politische Entscheidungen wissenschaftliche Erkenntnisse miteinbeziehen. Dabei dürfe aber weder die Vielfalt der wissenschaftlichen Diskurse ausser Acht gelassen werden, noch dürfe man sich hinter vermeintlichen «Sachzwängen» verstecken. Eine offene Gesellschaft zu verteidigen bedeute, die vielfältigen Ansichten und Bedürfnisse miteinander friedlich in Einklang zu bringen. Voraussetzung dafür sei ein freier Diskurs, nicht eine moralisierende «Cancle Culture».
 In seinem Referat befasste sich Andreas Tiedtke, Buchautor, Rechtsanwalt und Vorstand des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, mit der Frage, welche wissenschaftlichen Methoden zu welchen Erkenntnissen führen. Es gebe erstens die «erfahrungsunabhängigen Wissenschaften», die «von vornherein» gültige Aussagen enthalten, wie die Mathematik, die Logik und die Praxeologie. Zweitens gebe es die empirischen Wissenschaften, welche in die Naturwissenschaften und die wissenschaftliche Methode des eigentümlichen Verstehens unterteilt werden könnten. Für die Testbarkeit einer naturwissenschaftlichen Hypothese sei entscheidend, dass prinzipiell jedermann jederzeit die Tests wiederholen könne und dass sich die massgeblichen Ursachen für die konstanten Zusammenhänge isolieren liessen. Während es bei den Naturwissenschaften um objektiv testbare Zusammenhänge zwischen äusseren (metrischen, also mess- oder zählbaren) Grössen gehe, komme mit der wissenschaftlichen Methode des Verstehens, das die klassische Methode der empirischen Geisteswissenschaften, der Sozial- und Geschichtswissenschaften sei, ein subjektives Element ins Spiel, nämlich das persönliche Relevanzurteil. Das sei der Grund, warum die Analysen der Historiker, der Soziologen oder der empirischen Volkswirte so weit auseinandergingen. Sofern Annahmen nicht die Analyse der Vergangenheit betreffen, sondern künftiges Geschehen, könnten wir anstatt von Verstehen von Mutmassen sprechen.
In seinem Referat befasste sich Andreas Tiedtke, Buchautor, Rechtsanwalt und Vorstand des Ludwig von Mises Instituts Deutschland, mit der Frage, welche wissenschaftlichen Methoden zu welchen Erkenntnissen führen. Es gebe erstens die «erfahrungsunabhängigen Wissenschaften», die «von vornherein» gültige Aussagen enthalten, wie die Mathematik, die Logik und die Praxeologie. Zweitens gebe es die empirischen Wissenschaften, welche in die Naturwissenschaften und die wissenschaftliche Methode des eigentümlichen Verstehens unterteilt werden könnten. Für die Testbarkeit einer naturwissenschaftlichen Hypothese sei entscheidend, dass prinzipiell jedermann jederzeit die Tests wiederholen könne und dass sich die massgeblichen Ursachen für die konstanten Zusammenhänge isolieren liessen. Während es bei den Naturwissenschaften um objektiv testbare Zusammenhänge zwischen äusseren (metrischen, also mess- oder zählbaren) Grössen gehe, komme mit der wissenschaftlichen Methode des Verstehens, das die klassische Methode der empirischen Geisteswissenschaften, der Sozial- und Geschichtswissenschaften sei, ein subjektives Element ins Spiel, nämlich das persönliche Relevanzurteil. Das sei der Grund, warum die Analysen der Historiker, der Soziologen oder der empirischen Volkswirte so weit auseinandergingen. Sofern Annahmen nicht die Analyse der Vergangenheit betreffen, sondern künftiges Geschehen, könnten wir anstatt von Verstehen von Mutmassen sprechen.
Oftmals würden harte wissenschaftliche Erkenntnisse behauptet, wo es sich eigentlich nur um «soft science» handle. Beim Erdklima etwa handle es sich um ein komplexes geschichtliches Phänomen mit Rückkoppelungen. Wie bedeutsam der Faktor «menschliche CO2-Emmissionen» im Hinblick auf Temperatur und Meeresspiegel sei, lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen, weil Daten, die aus historischen, komplexen Phänomenen mit Rückkoppelung gewonnen werden, von vornherein nicht Beweis für kausale Zusammenhänge erbringen könnten. Auch bei den Mutmassungen im Zusammenhang mit den staatlichen Zwangsmassnahmen im Hinblick auf die Krankheitswelle «Corona» hätten wir es mit informierten eigentümlichen, also subjektiven Mutmassungen zu tun. Auch hier kämen verschiedene Experten zu verschiedenen Mutmassungen im Hinblick auf Ansteckung, Gefährlichkeit und welche Massnahmen zu ergreifen wären. Es sei also unredlich, wenn Politiker versuchten, Zwangsmassnahmen im Namen des «Klimaschutzes» oder des «Gesundheitsschutzes» wissenschaftlich zu begründen, weil es hier keine zweifelsfreien, objektiven Nachweise gebe. Der Totalitarismus sei die logische Folge davon, dass die Methode des informierten Mutmassens in den Rang «gesicherten Wissens» erhoben werde.
 Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne und Stiftungsrat des Liberalen Instituts, machte darauf aufmerksam, dass man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen könne, dass die politische Reaktion insbesondere auf die Corona-Virenwellen und den Klimawandel eine erfreuliche Entwicklung einläuteten. Nämlich dass die Politik sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten liesse, statt — wie sonst üblich — von vielfältigen Interessengruppen. Doch leider sei das Gegenteil der Fall: Ein Versagen der Wissenschaft. Das heutige Programm «follow the science» sei ein anti-wissenschaftliches Programm, das sich den Namen von Wissenschaft gebe. Denn «follow the science» könne man als politisches Programm nur dann formulieren, wenn man die methodische Skepsis über Bord werfe, die schon René Descartes als Voraussetzung der Wissenschaft definiert hatte. Die fälschlicherweise so genannte «Wissenschaft» sei im Grunde genommen nichts als ein politisches Programm. Es sei eine Ideologie, die als unbezweifelbare Wahrheit dargestellt werde, wobei sich deren Vertreter mit zweifelhaften Mitteln dagegen stemmten, dass man ihre Aussagen überprüfen dürfe.
Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne und Stiftungsrat des Liberalen Instituts, machte darauf aufmerksam, dass man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen könne, dass die politische Reaktion insbesondere auf die Corona-Virenwellen und den Klimawandel eine erfreuliche Entwicklung einläuteten. Nämlich dass die Politik sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten liesse, statt — wie sonst üblich — von vielfältigen Interessengruppen. Doch leider sei das Gegenteil der Fall: Ein Versagen der Wissenschaft. Das heutige Programm «follow the science» sei ein anti-wissenschaftliches Programm, das sich den Namen von Wissenschaft gebe. Denn «follow the science» könne man als politisches Programm nur dann formulieren, wenn man die methodische Skepsis über Bord werfe, die schon René Descartes als Voraussetzung der Wissenschaft definiert hatte. Die fälschlicherweise so genannte «Wissenschaft» sei im Grunde genommen nichts als ein politisches Programm. Es sei eine Ideologie, die als unbezweifelbare Wahrheit dargestellt werde, wobei sich deren Vertreter mit zweifelhaften Mitteln dagegen stemmten, dass man ihre Aussagen überprüfen dürfe.
Skepsis als Methode der Wahrheitsfindung, die die moderne Naturwissenschaft kennzeichne, habe nichts mit der intellektuellen Dekonstruktion zu tun, die das postmoderne Denken charakterisiere: Diese Dekonstruktion bestehe darin, den Einsatz von Vernunft und das Erheben von Wahrheitsansprüchen als Machtansprüche zu disqualifizieren. Wenn aber Wahrheit als Ziel und disziplinierte Skepsis als Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, entfallen, dann bliebe nur Gewalt übrig. So geschehen insbesondere bei den Themen Corona und Klima: Eine Behauptung werde mit verbaler Gewalt als wahr und wissenschaftlich abschliessend bewiesen festgesetzt, nämlich einfach dadurch, dass sie von Personen in den Medien verbreitet werde, die eben diese Medien als Experten präsentierten. Gegenteilige Behauptungen würden zu «fake news» erklärt und auf Internetplattformen gelöscht. Ein Wahrheitsanspruch sei kein Erkenntnisanspruch mehr, welcher der Prüfung ausgesetzt werde und standhalten müsse, sondern ein Autoritäts- und Machtanspruch, der durch die Einschüchterung allen Hinterfragens durchgesetzt werde.
 In ihrem Referat befasste sich Margit Osterloh, Forschungsdirektorin des Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA) in Zürich sowie permanente Gastprofessorin an der Universität Basel, mit möglichen Strategien zur Eindämmung des Autoritätsvirus in Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Form des Autoritätsvirus in der Wissenschaft sei die Überantwortung von Qualitätsbeurteilungen an eine externe Instanz in der Form von Rankings. Es seien dies Rankings von Zeitschriften, in welchen wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht worden sind. Rankings suggerierten, dass ein Argument oder Forschungsergebnis in einer hochrangigen Zeitschrift besser seien als solche, die in Journals mit einem geringeren «impact factor» veröffentlicht wurden. Der «impact factor» gebe an, wie oft die in einem Journal veröffentlichten Beiträge im Durchschnitt innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zitiert werden. Weil sich dieser Durchschnitt aus sehr wenigen hoch zitierten und vielen wenig oder kaum zitierten Aufsätzen errechne, sage er nichts über die Qualität eines einzelnen, in dieser Zeitschrift veröffentlichten Arbeit aus. Das Qualitäts-Mass «impact factor» sei also unsinnig. Dennoch werde es in vielen Disziplinen angewendet und bilde die Grundlage von Rankings. Diese stellten heute wissenschaftliche Autorität dar, obwohl sie in mehrfacher Hinsicht unwissenschaftlich seien.
In ihrem Referat befasste sich Margit Osterloh, Forschungsdirektorin des Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA) in Zürich sowie permanente Gastprofessorin an der Universität Basel, mit möglichen Strategien zur Eindämmung des Autoritätsvirus in Wissenschaft und Wirtschaft. Eine Form des Autoritätsvirus in der Wissenschaft sei die Überantwortung von Qualitätsbeurteilungen an eine externe Instanz in der Form von Rankings. Es seien dies Rankings von Zeitschriften, in welchen wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht worden sind. Rankings suggerierten, dass ein Argument oder Forschungsergebnis in einer hochrangigen Zeitschrift besser seien als solche, die in Journals mit einem geringeren «impact factor» veröffentlicht wurden. Der «impact factor» gebe an, wie oft die in einem Journal veröffentlichten Beiträge im Durchschnitt innerhalb eines bestimmten Zeitraumes zitiert werden. Weil sich dieser Durchschnitt aus sehr wenigen hoch zitierten und vielen wenig oder kaum zitierten Aufsätzen errechne, sage er nichts über die Qualität eines einzelnen, in dieser Zeitschrift veröffentlichten Arbeit aus. Das Qualitäts-Mass «impact factor» sei also unsinnig. Dennoch werde es in vielen Disziplinen angewendet und bilde die Grundlage von Rankings. Diese stellten heute wissenschaftliche Autorität dar, obwohl sie in mehrfacher Hinsicht unwissenschaftlich seien.
Es gelte, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, um den Einfluss der Autoritäten zu begrenzen. Eine wichtige Massnahme sei die Einführung eines qualifizierten Losverfahrens zur Ernennung wichtiger Positionen. Dieses Verfahren sei von Aristoteles als die einzig wahrhaft demokratische Institution bezeichnet worden, weil es alle Formen von Machtkonzentration unterbinde. Die Vorteile eines solchen qualifizierten Losverfahrens seien z.B. im Anwendungsbereich der Forschung die Verhinderung von «old boys»-Netzwerken, die Vergrösserung des Pools an kreativen Ideen und Forschenden, die Reduktion von Hybris sowie die Erhöhung der Fähigkeiten- und Ideen-Diversität.
 In der darauffolgenden Diskussion mit dem Publikum wurde unter anderem die Frage diskutiert, ob die Wissenschaft der Politik überhaupt verbindliche Vorgaben machen könne, wie diese auf bestimmte Phänomene reagieren müsse. Politischer Missbrauch von Wissenschaft finde immer dann statt, wenn Wissenschaft sich nicht darauf beschränke, Tatsachen zu entdecken, sondern sich anmasse, Normen vorzugeben. Sie überschreite dann die Trennlinie zwischen dem Aufdecken, was der Fall ist, und dem Vorschreiben, was der Fall sein soll. Sobald Wissenschaft die Politik «berate» und ihr Anweisungen gebe, werde sie zu einer Kraft, die sich gegen den Rechtsstaat stelle: Die Entscheidungen darüber, was politisch geschehen soll, würde dann nicht mehr der Abwägung der Menschen überlassen, sondern an tatsächliche oder vermeintliche «Experten» delegiert. Antworten auf politische Fragen liessen sich aber nicht wissenschaftlich erzeugen. Solche Antworten müssten unter fairer Beteiligung aller Diskurswilligen entwickelt werden.
In der darauffolgenden Diskussion mit dem Publikum wurde unter anderem die Frage diskutiert, ob die Wissenschaft der Politik überhaupt verbindliche Vorgaben machen könne, wie diese auf bestimmte Phänomene reagieren müsse. Politischer Missbrauch von Wissenschaft finde immer dann statt, wenn Wissenschaft sich nicht darauf beschränke, Tatsachen zu entdecken, sondern sich anmasse, Normen vorzugeben. Sie überschreite dann die Trennlinie zwischen dem Aufdecken, was der Fall ist, und dem Vorschreiben, was der Fall sein soll. Sobald Wissenschaft die Politik «berate» und ihr Anweisungen gebe, werde sie zu einer Kraft, die sich gegen den Rechtsstaat stelle: Die Entscheidungen darüber, was politisch geschehen soll, würde dann nicht mehr der Abwägung der Menschen überlassen, sondern an tatsächliche oder vermeintliche «Experten» delegiert. Antworten auf politische Fragen liessen sich aber nicht wissenschaftlich erzeugen. Solche Antworten müssten unter fairer Beteiligung aller Diskurswilligen entwickelt werden.
Bestellen Sie hier das neue Buch der Edition Liberales Institut von Olivier Kessler und Peter Ruch (Hrsg.) «Wissenschaft und Politik: Zuverlässige oder unheilige Allianz?».
Tags:
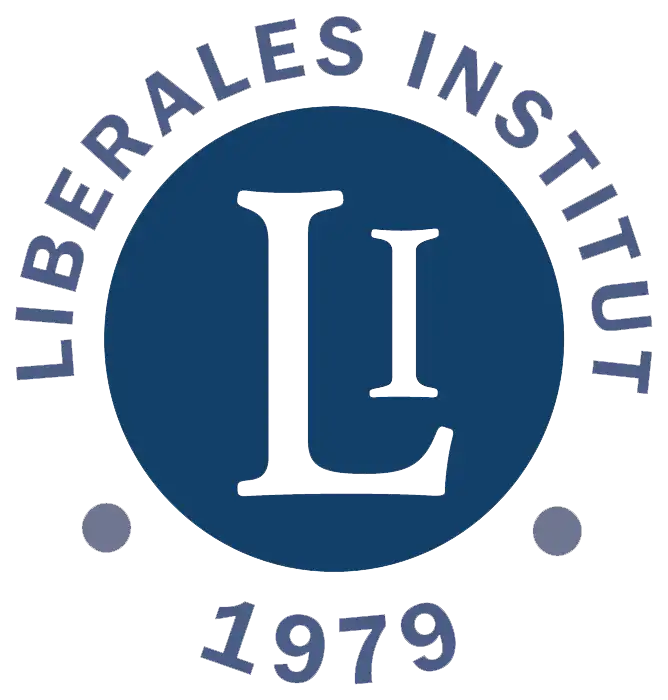
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.