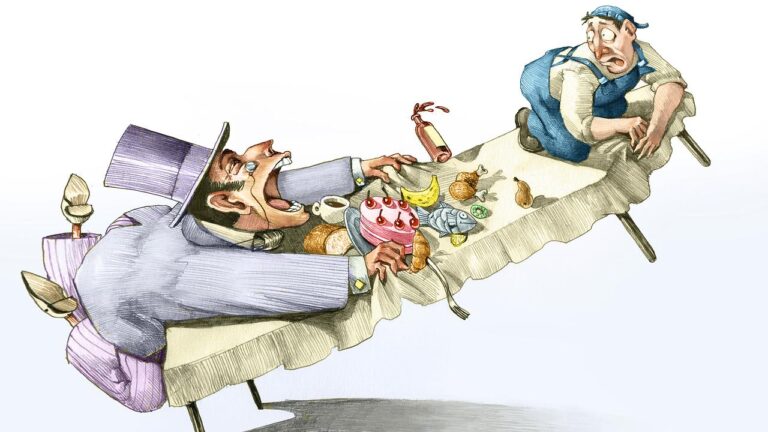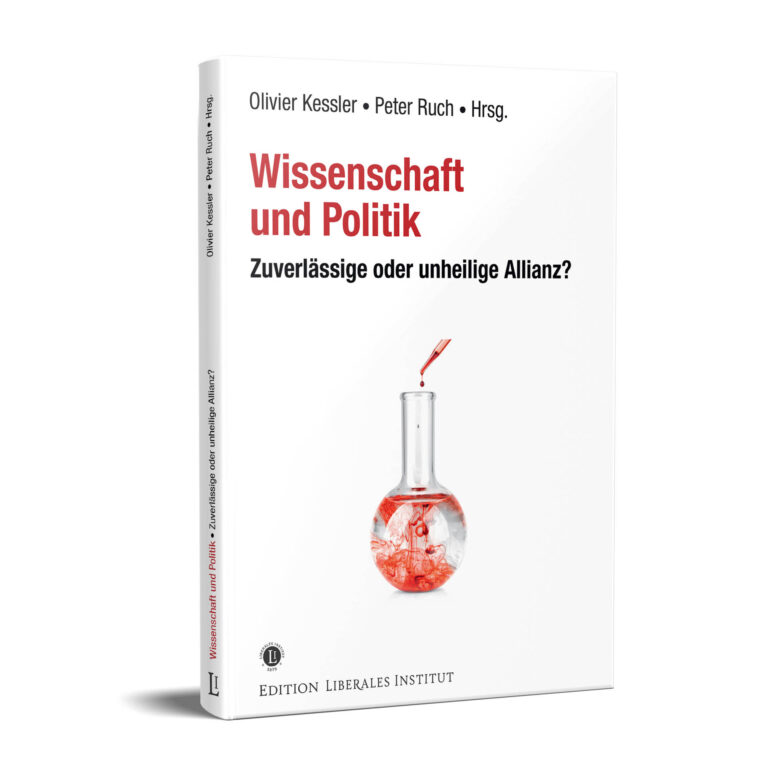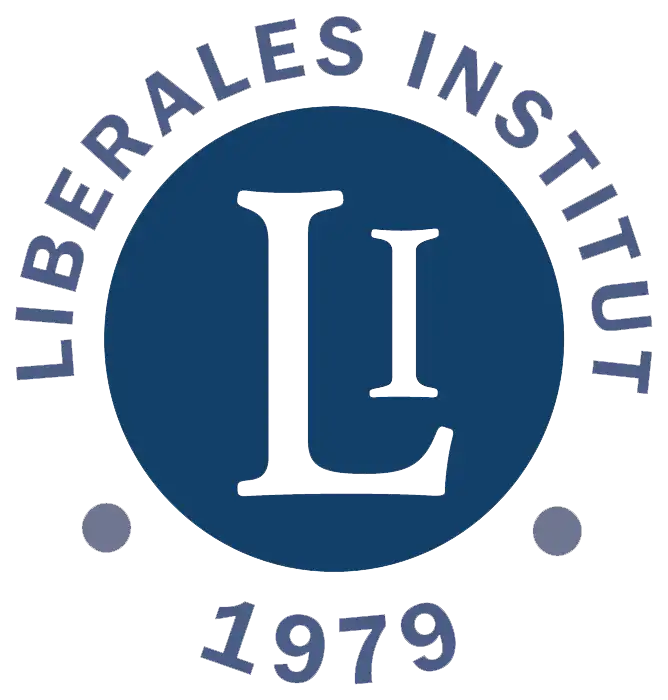Testen Sie ihr
liberales Wissen
Sie glauben alles über den Liberalismus zu wissen?
Finden wir es heraus.
Über das Institut
Der neue
KI-Chatbot ist da
Sie haben eine Frage zum Liberalismus, zu unseren Inhalten oder zum Liberalen Institut?
Fragen Sie ganz einfach unseren Chatbot, indem Sie unten rechts auf das Icon klicken. Sie erhalten dann umgehend eine Antwort.
Denkanstösse
News
Liberty Summer School
Jedes Jahr erhalten 25 Nachwuchstalente während vier Tagen eine spannende Einführung in die Grundlagen von Frieden, Freiheit und Wohlstand.