
Die Briten haben sich für den EU-Austritt entschieden, weil sie aufgrund ihrer Abneigung gegen staatliche Regulierungen in eine systematische Minderheitsposition geraten waren. Frankreich, das regulierungsfreudigste Land der EU, verfolgt die «Strategy of Raising Rivals‘ Costs».
Es ist vielfach gerätselt worden, weshalb David Cameron vor der Unterhauswahl von 2015 das Versprechen abgab, im Falle seiner Wiederwahl innerhalb von zwei Jahren ein Referendum über den Verbleib Grossbritanniens in der EU abzuhalten. Dahinter steckte wohl politisches Kalkül: Die Konservative Partei verfehlte 2010 die Mehrheit der Sitze, was nicht passiert wäre, wenn die UKIP-Wähler in einzelnen Wahlkreisen für die konservativen Kandidaten gestimmt hätten. Camerons Ziel musste es daher sein, der UKIP bei den nächsten Unterhauswahlen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Weshalb siegten in der Volksabstimmung die «Leavers»? Hier ist die gängige Erklärung, dass die anderen EU-Staaten nicht bereit waren, den Briten eine autonome Einwanderungspolitik zuzugestehen. Doch der britische Unmut über die EU hatte sich schon über längere Zeit aufgebaut. Denn die Briten waren seit den 1990er Jahren immer wieder in wichtigen Fragen im Rat und Parlament überstimmt worden. Meistens ging es dabei um Arbeits- und Finanzmarktregulierungen, d.h. um Eingriffe in die Vertragsfreiheit.
Warum taten die verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten alles, um den Austritt der Briten zu erschweren? Sie hatten ein fiskalisches Interesse, den Austritt des britischen Nettozahlers zu verhindern. Und weshalb weigerten sie sich, Grossbritannien ein Freihandelsabkommen zuzugestehen, wie sie es mit Kanada geschlossen hatten? Hätten sie das getan, hätten die Binnenmarktmitglieder Norwegen und Island, vielleicht sogar die Schweiz, vergleichbare Konditionen fordern können. Den Briten sollte der grösstmögliche Schaden zugefügt werden. Man wollte aus Angst vor weiteren Austritten ein Exempel statuieren. Ein Zeichen der Stärke ist das nicht.
Download LI-Paper
(7 Seiten, PDF)
Tags:
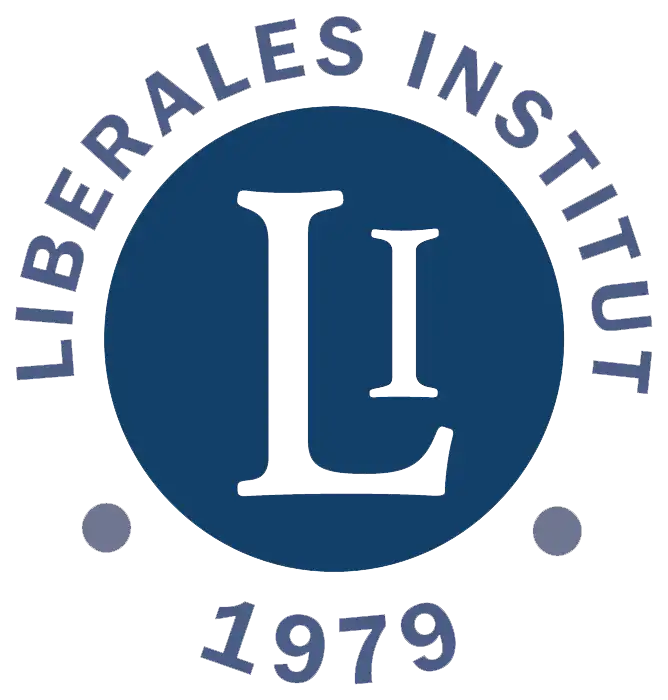
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.