
Der Glaube an das Recht als Hort der Freiheit («Rightism») verleitet zur tief verankerten Überzeugung, dass die Menschen das Recht hätten, gewisse Dinge zu tun und dass dafür andere Dinge nicht erlaubt seien. Wenn man näher hinschaut, bedeutet dies, dass diese «Rechte» eigentlich als Ausnahmen gedeutet werden von einer unausgesprochenen Grundannahme, alles andere sei verboten. Wäre dies nicht der Fall, so würde die Verkündung von «Rechten» welche an der Basis freier Willensakte stehen, überflüssig und gegenstandslos. Die Torheit, die hinter dem unreflektierten Glauben an den freiheitsstiftenden Rechtsstaat steckt und die erstaunliche Wirkung, welche die Idee im politischen Umfeld entfaltet, zeigt, wie weit sich das landläufige liberale Denken (loose liberalism) vom radikal liberalen Denken (strict liberalism) entfernt hat, das im Dienst der Freiheitsidee steht und nicht der verwirrenden Phrasendrescherei huldigt.“ Antony de Jasay (übersetzt von R.N.)
Auch rechtsstaatliche Verfassungen und Verfassungsgerichte bieten keine verlässliche Freiheitsgarantie, da sich die Macht der legislativen und richterlichen Interpreten auf die Dauer nie wirksam beschränken lässt. Ohne Rechtsstaat keine Freiheit, ohne Recht kein legitimer Staat und ohne Staat, so argumentieren viele, kein Recht. So präsentiert sich der Ansatz, den man auch Verfassungsliberalismus bzw. Verfassungspatriotismus nennen kann.
Für die klassischen Liberalen, die Ordoliberalen und die Rechtspositivisten spielt der Rechtsstaat eine zentrale Rolle, weil man in ihm die Voraussetzung für die Freiheit sieht, keine stets hinreichende, aber stets eine notwendige. Wer von diesem Ansatz ausgeht, gelangt konsequenterweise zum Schluss, dass wir unsere Freiheit eigentlich dem Staat verdanken, der sie nicht nur garantiert, sondern tatsächlich kreiert. Auch der Markt, auch die Privatautonomie, werden so zu «Veranstaltungen», zu Institutionen des Staates. Aus dieser Sicht kann man dann im Brustton der liberalen Überzeugung einen «starken und mächtigen Staat» fordern, der im richtigen Moment eingreift und durchgreift, der weiss, was gut ist für alle: Law and order.
Wer in der verfassungsmässigen Gesetzgebung die Garantin für den Schutz Freiheitsrechte sieht, muss konsequenterweise auch eine Instanz fordern, welche wirksam darüber wacht, dass nicht einmal der Gesetzgeber in die individuelle Freiheit eingreifen kann. Die wichtigste Aufgabe des Staates ist der Schutz der Freiheit. Freiheit ist, gerade dort, wo sie für die Gesellschaft relevant und interessant ist, am meisten durch den nivellierenden und disziplinierenden Zugriff durch Mehrheiten gefährdet. Sie ist häufig das Anliegen von kreativen Minderheiten, das vor Mehrheiten, die lieber Sicherheit wollen, geschützt werden muss.
Ordoliberalismus ist vieldeutig, weil «ordo» gleichzeitig Staatsordnung und Gesellschaftsordnung meinen kann und nichts darüber aussagt, welche Ordnung nun primär ist und die andere hervorbringt. «Gesellschaftsordnung bringt Staatsordnung hervor», das wäre die konservative, naturrechtliche Variante, «Staatsordnung bringt Gesellschaftsordnung hervor», das wäre die rechtspositivistische, etatistische verfassungsliberale Variante. Aber wer garantiert für die Spielräume, die schöpferische Unordnung, die Spontanität? Freiheit, definiert als Abwesenheit von Zwang, entwickelt sich in der Dialektik zwischen Ordnung und Chaos. Ist das eine Frage des Prinzips, oder doch nur eine Frage des Masses? Natürlich gibt es «ordnungspolitisch» noch Mischformen mit historischen oder dialektischen Erklärungen, nach denen beide Ordnungen letztlich in ihrer Komplexität evolutionär unentwirrbar verbunden sind, bzw. dialektisch aufeinander Bezug nehmen. Wer so argumentiert, hat eigentlich immer Recht, kann aber dafür recht wenig erklären und begründen.
Aus einer staatsskeptischen Sicht wird der Rechtsstaat, d.h. die «rule of law» masslos überschätzt. Er wird nur darum so wichtig, weil der Staat seit dem Absolutismus eine nicht, bzw. nicht mehr zu rechtfertigende Vormachtstellung geniesst. Wir sind alle staatsgläubig und staatssüchtig, ohne es voll zu realisieren, weil uns staatliche Institutionen geformt und deformiert haben. Selbstverständlich ist es richtig, — wenn wir nun den Staat (dem wir fast die Hälfte unserer Einkünfte abliefern) schon einmal haben —, dass er dann so rechtsstaatlich wie möglich ist. Der Rechtsstaat mildert das Übel des Staates, aber er ist keine Wohltat an sich.
Leon Louw aus Südafrika hat schon im Jahr 2002 in einem Referat vor der «Mont Pèlerin Society» in London mit guten Gründen auf die Tatsache hingewiesen, dass man mit der «rule of law» auch ganze Kaskaden von Interventionen rechtfertigen kann. Der Schutz vor Willkür ist kein Schutz vor Irrtum und vor Fehlern. Auch die subtile, letztlich persönlich wertende Unterscheidung von «materiellem» und «formellem» Rechtsstaat hilft nicht weiter. Man kann auch die übelsten Fehlprogramme in den Formen des Rechts abwickeln, und auch ein unfreiheitlicher Interventionsstaat kann sich peinlich genau an rechtsstaatliche Prozeduren halten. Die Formel, in der die libertäre Grundauffassung zum Rechtsstaat zum Ausdruck kommt, müsste folgendermassen lauten: «Wenn schon Staat, dann Rechtsstaat.»
Aber charakterisiert diese Formel tatsächlich die Beurteilung des Rechtsstaats aus staatsskeptischer Sicht? Wieviel Staat soll’s denn geben, und welche Voraussetzungen sind für einen geordneten Rückzug aus dem Staat als grundlegendem Ordnungsprinzip geeignet? Wird dem Staat durch die «rule of law» nicht allzu oft ein trügerischer und damit gefährlicher Heiligenschein verpasst? Wird er dadurch nicht zum Wolf im Schafspelz? Wäre es nicht besser, wenn eine Organisation, die letztlich auf Zwang basiert, mit der ganzen Brutalität zeigen würde, was Fremdbestimmung heisst. Jenes Regierungsmitglied einer kantonalen Behörde, das sagte, das schönste am Regieren sei die Willkür, war der Realität recht nahe. Die Macht wird dadurch nicht voll entgiftet, dass sie im Mantel des Rechts auftritt, vielleicht kann sie auf den Samtpfoten der «rule of law» sogar noch subtiler und perfider wirken. Die Menschen werden dann an das gewöhnt, was sie eigentlich unfrei macht. Die «rule of law» als «Gesslerhut», dem man die Reverenz erweisen muss oder gar die brutale Maschinerie in der «Strafkolonie» von Franz Kafka, die der Gemarterte letztlich als Wohltat empfindet?
Man sollte allerdings das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Wenn die Dimensionen zurechtgerückt werden, bleibt viel Positives. Aber die «rule of law» ist keine freiheitsschaffende bzw. freiheitsgarantierende Basis des Zusammenlebens. Entscheidend für das Funktionieren einer Gesellschaft sind andere Prinzipien. In erster Linie der Friede, der auf einem teilweisen Verzicht auf das Durchsetzen der eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen beruht, auf einem «Ja zur Unschärfe», auf dem Akzeptieren der Verjährung, auf der Unschuldsvermutung, auf dem Verzicht auf allgemeinverbindliche Letztbegründungen, auf dem «common-sense» des anständigen Durchschnittsmenschen, auf dem Verzicht bei andern und bei sich selbst nach den letzten Motiven des Handelns und Verhaltens zu fragen, auf einem Erwachen aus dem Alptraum rächender und kompensierender Geschichtlichkeit in der eigenen Biographie und in der Geschichte der Gemeinschaft, in der man lebt. Neben dem «Prinzip Frieden» beruht die Gesellschaft auf dem Prinzip von «Treu und Glauben» (bona fides, fidelity), eine Art «Sympathiegenerator», den man letztlich im eigenen Interesse beachtet und der auch die Wurzel einer generellen Unschuldsvermutung bildet.
Möglicherweise könnten Gesellschaften auf dieser Basis auch ohne den traditionellen nationalstaatlichen Überbau überleben und florieren, als «Eid-genossenschaften». Es gibt leider diesbezüglich erst wenige überzeugende Modelle und Experimente, aber doch vielversprechende Ansätze. Die Zukunft einer arbeitsteilig hoch vernetzten, globalisierenden Dienstleistungsgesellschaft liegt bei reinen Zivilrechtsgesellschaften mit umfassender Privatautonomie, die sich auf einen gesellschaftlichen und nicht auf einen staatlichen «ordo» stützen. Das Primat der Politik wird abgelöst durch das Primat der Gesellschaft, der «homo politicus» durch den «homo oeconomicus cultivatus».
Aus dieser Sicht wird die «rule of law» entdramatisiert. Sie wird zur «Anstandsregel» für die politischen Machtträger (soweit und so lange politische Macht überhaupt noch notwendig ist), zum Zaum, welcher die rechtliche Zwangsorganisation erträglicher macht, zu einem Anwendungsfall des Prinzips von «Treu und Glauben», des Willkürverbots, der Verhältnismässigkeit, der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit durch Regelmässigkeit im umfassenden Sinn, Prinzipien an die auch der zivilisierte Staat gebunden ist, solange es ihn noch gibt. Wer den Staat als Vertrag deutet, und das Recht als «allgemeine Geschäftsbedingungen» unter denen sich dieser Vertrag abwickelt, wird unschwer die Verwandtschaft der «Rechtsstaatlichkeit» mit dem «Prinzip von Treu und Glauben» erkennen, gewissermassen ein Anwendungsfall des Willkürverbots unter zivilisierten Menschen, eine Spielregel, eine unverzichtbare Quelle, die — relative — Verlässlichkeit schafft, in einem an sich unerfreulichen und möglicherweise längerfristig verzichtbaren Subordinationsverhältnis zwischen Bürger und Staat.
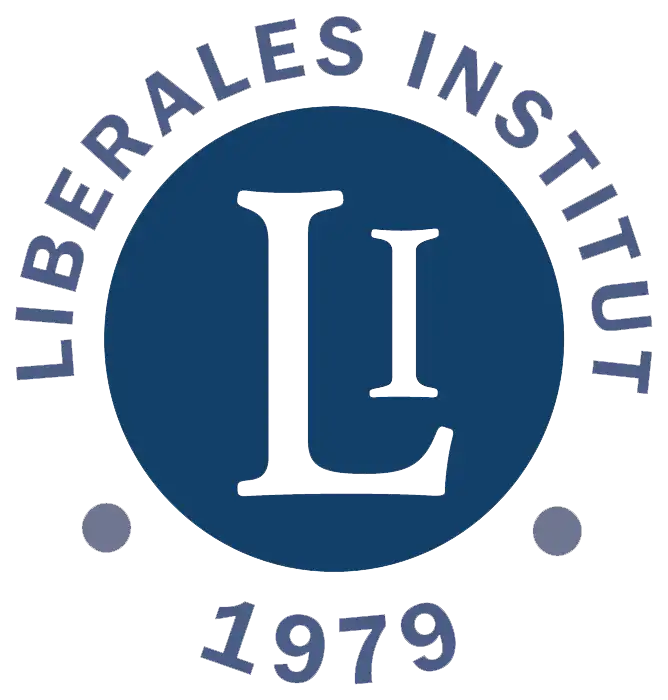
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.