
Es geht im folgenden Beitrag nicht um den Klimawandel, sondern um die Klimapolitik, also die instrumentelle Umsetzung der im Pariser Abkommen von 2015 gesetzten Klimaziele durch CO2-Steuern im Allgemeinen und den möglichen schweizerischen Alleingang mit globalem Vorbildcharakter im Speziellen. Die Kritik am gewählten Ansatz stützt sich daher nicht auf die Klimaforschung, sondern die Politische Ökonomie.
Es ist eine gewisse Tragik, dass die oft kontra-intuitive Ökonomie in der Politik wenig Chancen hat, aber ausgerechnet die von Arthur Cecil Pigou 1920 vorgeschlagenen Lenkungsabgaben (Pigou-Steuern) politisch grossen Anklang finden — meist jedoch in verzerrter oder falscher Interpretation.
Lenkungsabgaben korrigieren — im Modell oder auf der Wandtafel elegant — «Marktversagen» bei externen Kosten. Marktversagen ist politisch attraktiv, weil es bei der marktkritischen bis -feindlichen Bevölkerung viel Echo findet, aber vor allem in Bundesämtern, Interessenverbänden und NGOs willkommene Interventionsfester und Subventionsschubladen öffnet.
Ob externe Effekte überhaupt Marktversagen sind, hat Ronald Coase schon 1960 grundsätzlich infrage gestellt. Sein Theorem besagt, dass bei einer umfassenden Zuteilung der Eigentumsrechte auch der Markt die externen Effekte optimiert. Bei externen Nutzen spielt das in den meisten Fällen. Leider ist aber die Markteffizienz auf Güter und Dienste mit privatem Eigentum beschränkt.
Es geht bei Lenkungsabgaben ökonomisch betrachtet darum, den Marktpreis mit einem Steuerzuschlag um die sogenannten externen Kosten — sei es bei der Produktion oder dem Konsum — zu erhöhen, was das «soziale Optimum» gewährleisten soll. Preise sind nach der Pigou-Korrektur im Idealfall gleich den sozialen Kosten. Die Lenkung über Preise gilt in der Regel als der bessere Ansatz als die Regulierung über Gebote und Verbote. Doch das ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen der Fall, die bei der politischen Umsetzung meistens verletzt werden. Wenn die Politik in die falsche Richtung zu lenken versucht, sind Marktkorrekturen via Preissignale schädlicher als Vorschriften für das Verhalten oder Mengenrestriktionen.
Viel wichtiger ist aber, dass Pigou-Steuern bei globalen Umweltproblemen mit nicht-erneuerbaren Ressourcen von Vornherein der falsche Ansatz sind. Das hat Harold Hotelling bereits 1931 modellmässig für endliche Ressourcen überzeugend begründet. Die Verbrennung von endlichen fossilen Brennstoffen ist etwas ganz anderes als die Verbrennung von Zigaretten. Letztere werden laufend aus erneuerbarem Tabak produziert. Der Verzicht auf oder das Verbot zum Rauchen hat keine weiteren sozialen Kosten zur Folge. Zudem bleiben die externen Kosten des Rauchens individuell oder schlimmstenfalls lokal. Die Internalisierung der sozialen Kosten via den Preis beschränkt sich auf die Substitution weg von Zigaretten und hin zu weniger schädlichen Genussmitteln. Die Preise für produzierte Konsumgüter mit Pigou-Steuern haben volkswirtschaftlich keine negativen Rückwirkungen.
Im Gegensatz dazu belastet eine CO2-Steuer eben nicht produzierte Güter, sondern den Verbrauch erschöpfbarer Ressourcen. Deren Preise wiederspiegeln nicht nur die Förderkosten, sondern enthalten auch eine erhebliche (unverdiente) Knappheitsrente als Geschenk an den Eigentümer. Daraus folgt, dass es nicht nur um die Substitution von Öl oder Gas durch Sonne und Wind (analog von Zigaretten durch Kaugummi) geht, sondern vielmehr nach Hotelling um die Substitution zwischen dem Verbrauch von heute, morgen und übermorgen. Oder anders gesagt: Eine globale Pigou-Steuer kann wohl den jährlichen Weltverbrauch senken, aber gleichzeitig die Anzahl der Nutzungsjahre so verlängern, dass die CO2-Emissionen langfristig konstant bleiben.
«Oil in the ground is like money in the bank.» Es ist ein Vermögen im Boden wie Gold oder Eisenerz mit einer Knappheitsrente, die so lange ausgeschöpft wird, bis die Extraktionskosten plus CO2-Steuer höher werden als die Preise der technischen Alternativen. Diese Reserven sind genauso «gratis» wie Sonne, Wind oder Erdwärme. Ihre Umwandlung in nutzbare Energieformen wie Strom ist jedoch bei den sog. Erneuerbaren genauso wie bei Gas und Öl mit Kosten verbunden. Bei Öl und Gas ist die Extraktion aufwändig; aber die Energiedichte, Transport-, Lagerfähigkeit und Planbarkeit sind im Gegensatz zu Sonne und Wind enorm hoch. Dass die Neuen Erneuerbaren deshalb Öl und Gas selbst bei hohen Pigou-Steuern aus dem Markt drängen, ist daher bis ins Jahr 2100 unwahrscheinlich.
Entscheidend sind dabei beim Strom nicht die erst noch subventionierten Einspeisepreise, sondern die Verbraucherpreise auf der Netzebene. Anders gesagt: Die vorhandenen und bereits heute schon bekannten Reserven beim Erdöl oder Erdgas werden mit oder ohne Lenkungsabgaben so oder so weitgehend ausgeschöpft und belasten somit die Atmosphäre nur marginal weniger, weil der Zeitpunkt der Emission nicht wichtig ist.
Bei Kohle sieht das anders aus, weil bereits die Förderkosten hoch sind, was schon heute auch ohne CO2-Steuer zum Ersatz durch Öl und vor allem Gas führt (siehe USA). Hans Werner Sinn hat 2015 ein Green Paradox vorgestellt, wo die Erwartungen steigender Steuersätze den CO2-Ausstoss sogar noch erhöhen.
Im NBER Arbeitspapier Nr. 26086 schätzen die Verfasser Geoffrey Heal und Wolfram Schlenker gestützt auf eine umfassende Datenbasis, dass selbst mit einer weltweiten CO2-Steuer von happigen 200 Franken pro Tonne CO2 die kumulativen Emissionen aus Erdöl um schäbige 4% zurückgingen. Bei 100 Franken pro Tonne wären es bloss 1,6%. Um den totalen Ausstoss der Ölbranche um 50% zu reduzieren, wären mehr als 500 Franken pro Tonne erforderlich. Der Grund: Bei hohen Preisen wird das Angebot von Ölreserven immer steiler.
Pigou-Steuern in einzelnen Ländern und Regionen sind schon deshalb praktisch wirkungslos, weil sich einerseits die energieintensive Produktion in steuerfreie Länder verlagert (Leakage) und anderseits die Reserven einfach von anderen ausgeschöpft werden.
Doch untersuchen wir im Folgenden den vorgesehen Schweizer-Kurs für eine Lenkungsabgabe auf CO2 aus politökonomischer Perspektive. Die Schweiz hat nämlich beim Pariser Abkommen von 2015 insofern bereits einen Alleingang für einen Netto-Null-Ausstoss bis 2050 vom Parlament absegnen lassen. Diese innenpolitisch abgesicherte Selbstverpflichtung soll unabhängig davon gelten, ob sich andere Länder an ihre Reduktionsversprechen halten oder nicht. In der Schweiz ist im neuen Parlament nicht mehr das ohnehin illusionäre Null-Ziel die politische Grundsatz-Frage, sondern die Vorverlegung von 2050 auf 2030. Der Wettlauf beschränkt sich auf den Zeithorizont und wird dadurch immer schädlicher.
1. Eine Lenkungsabgabe zur Kompensation von externen Kosten ist eine marktspezifische Partialbetrachtung, sollte jedoch in ihrer Breitenwirkung gerade bei einer CO2-Steuer auch auf die Auswirkungen auf andere Märkte inklusive die Beschäftigung und den internationalen Handel analysiert werden. Dies ist deshalb besonders wichtig, weil Energie primär ein Input für Industrie, Gewerbe und Transport ist, also kein verzichtbares Konsumgut wie z.B. Zigaretten oder Alkohol. Die indirekten Auswirkungen auf den internationalen Produktionsstandort sind somit viel wichtiger als die direkten Folgen für die Haushalte, die in Politik und Medien beim Energiesparen bzw. der CO2-Vermeidung immer im Vordergrund stehen (Heizen, Fliegen, Elektrogeräte, etc). Auch ein Smart Grid mag den privaten Stromverbrauch marginal optimieren. Doch Gewerbe, Industrie oder Transport sind mehr denn je auf permanente Versorgungssicherheit angewiesen.
2. Reine Lenkungsabgaben sollten zu 100% an die Bevölkerung rückerstattet werden, um einen fiskalneutralen Preiseffekt zu garantieren. Dabei ist eine sogenannte «doppelte Dividende» (ökologisch und ökonomisch) nur dann zu erwarten, wenn zum einen die Lenkungsabgabe richtig angesetzt ist (siehe Punkt 3) und zum andern besonders verzerrende Steuern wie etwa die Unternehmenssteuern oder Sozialabgaben ersetzt. Die Rückerstattung löst jedoch sofort intensive Verteilungskonflikte aus, die primär sozial und eben nicht optimal gelöst werden. Früher oder später werden zudem Lenkungsabgaben ganz oder teilweise in zweckgebundene Steuern umgewandelt, die zusätzliche Subventionen finanzieren. Die Fiskal-Neutralität wird somit ausgehebelt, was teilweise gerade in der Schweiz schon heute der Fall ist.
Lenkungsabgaben sind somit politisch attraktiv, weil sie (scheinbar) Marktversagen korrigieren und simultan neue Profiteure für Rückerstattung und Subventionen schaffen. Damit wird der Steuerwiderstand moralisch und interessenpolitisch ausgehebelt. Ob das die Wertschöpfung fördert oder gar Innovationen auslöst, ist theoretisch und empirisch mehr als fragwürdig und für einen schweizerischen Alleingang beim CO2 mit weltrekordverdächtigen Ausmassen klar zu verneinen. CO2 aus der Luft abzusaugen oder im Boden zu speichern oder Windräder durch Drohnen zu ersetzen und Solarinseln auf Stauseen zu bauen, mag experimentell glücken, aber bleibt für die reale Energieversorgung unskalierbar und daher unwirtschaftlich. Die im Vergleich zu den externen Kosten zu hohe Abgabe führt zu nur zu neuen Ineffizienzen und internationalen Wettbewerbsnachteilen.
3. Die Höhe der globalen Lenkungsabgabe setzt eine zuverlässige Schätzung der externen Kosten voraus, die internalisiert werden sollten. Gerade beim CO2 ist das aber höchst umstritten und reicht mehr oder weniger von Null bis zu 200 oder gar 300 Franken pro Tonne. Diese Vermeidungskosten haben Markus Häring und Silvio Borner für die Gebäudesanierung im Kanton Baselland aus offiziellen Zahlen abgeleitet. William Nordhaus hat als Nobelpreisträger von 2018 die aktuellen externen Kosten kürzlich auf ca. 40 Dollar geschätzt, der Zertifikatspreis beträgt in der EU etwa 20 Euro, Tendenz steigend.
4. CO2 in der Atmosphäre ist der Paradefall eines echt globalen «Common» (Allmendproblem). Es kommt weder drauf an, wo die Emissionen erfolgen, noch wo die Reduktionen stattfinden. Wenn energieintensive Produktionsprozesse aus hoch besteuerten und daher CO2-armen Ländern in nicht oder nur schwach besteuerte und somit CO2-intensive Standorte (wie etwa China oder Indien) abwandern, nimmt der globale Ausstoss im Extremfall sogar zu (Leakage-Effekt). Umgekehrt bedeuten die 200-300 Franken pro Tonne CO2 — wie in der Schweiz von den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich für die Gebäudesanierung gefordert — eine volkswirtschaftlich und ökologisch schädliche Ressourcenverschleuderung. Wir schaden nur uns selber, nützen dem Klima aber rein gar nichts. Wir ersetzen nämlich schweizerischen CO2-Ausstoss durch einen Mehrverbrauch an «grauer Energie» aus eigenen Ressourcen und importierten Materialien.
5. Effizient wäre deshalb eine globale Obergrenze für den Ausstoss und international handelbare Zertifikate (Cap-and-Trade System), also genau das Gegenteil des Accord von Paris. Das ist jedoch momentan politisch ausser Reichweite. Zweitbeste Lösung für grössere Wirtschaftsräume wie etwa die USA oder die EU ist daher ein regionales Cap-and-Trade-System, bei dem die Schweiz bei der EU voll mitmachen kann und soll.
Ist der CO2-Ausstoss einmal gesamteuropäisch und mit jährlichen Reduktionszielen «gedeckelt», werden nationale Subventionen oder Lenkungsabgaben überflüssig, ja sogar schädlich. Was wir beispielsweise in der Schweiz zusätzlich an CO2 einsparen, senkt tendenziell nur den europäischen Preis für die Zertifikate und wird somit automatisch kompensiert. Oder wenn wir den Verkehr total elektrifizieren, aber den Zusatzbedarf mit deutschen Kohlestromimporten decken, brauchen die Deutschen mehr Zertifikate, während wir als Musterschüler dastehen. Die CO2-Belastung wird (momentan noch) rein produktionsseitig zugeteilt, aber die Verlagerung auf den Verbrauch ist absehbar und handelspolitisch als Einfallstor für grünen Protektionismus höchst problematisch.
6. Eine CO2-Steuer kann ähnlich wirksam sein wie ein Cap-and-Trade System, bei dem man die Menge absolut begrenzt und den Preis dem Markt für den Zertifikats-Handel überlässt. Eine CO2-Steuer fixiert den Preis und überlässt die Mengenanpassung dem Markt. Anpassungen der «Mengendeckel» sind beim Cap-and-Trade-System sicher einfacher als Erhöhungen der Steuersätze, und die Reduktionsziele können besser erreicht werden.
Ein globales Cap-and-Trade-System mit einem Reduktionsziel für die ganze Laufzeit würde gemäss Heal und Schlenker im Rahmen des Hotelling-Modells vor allem die Knappheitsrenten der Reserven-Eigentümer abschöpfen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine Versteigerung der Emissionsrechte.
Aus politökonomischer Sicht hat die Steuer jedoch zwei weitere schwerwiegende Nachteile. Zum einen führen die Lenkungsabgaben zu höheren Staatseinnahmen, die automatisch zu neuen Ausgaben verleiten. Selbst wenn die gesamten Erträge rückerstattet würden, entsteht einerseits ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand und andererseits ein politischer Kampf um die Geschenkverteilung. Der Basler Stromzuschlag ist dafür ein abschreckendes Beispiel. Wie beim Cap-and-Trade-Ansatz sind auch bei der CO2-Steuer nur grossräumige Lösungen wie für die USA, die EU oder allenfalls China überhaupt wirksam.
Angenommen, die Klimaforschung hat recht, und die menschgemachte Klimaerwärmung muss bis ins Jahr 2100 auf 1,5 Grad begrenzt werden, dann bedeutet die Halbierung des schweizerischen Ausstosses von jetzt 1 Promille Weltanteil einen Beitrag von fünf Zehntausendstel zur Weltrettung. Aber wenn China und Indien ihren Ausstoss gemäss Paris bestenfalls ab 2030 zu stabilisieren beginnen, ist eine weitere Produktionsverlagerung kontraproduktiv für unsere Wertschöpfung wie auch das Klima.
Sollten die IPCC-Prognosen in Zukunft nicht mehr wie bislang zu hoch ausfallen und die Erwärmung sich wegen der zu langsamen CO2-Vermeidung messbar beschleunigen, rücken plötzlich ganz andere und viel billigere Methoden zur Klimasteuerung in den Vordergrund, beispielsweise künstlich erzeugte Wolken oder Wiederbelebung der Nuklearproduktion. Aber zum jetzigen Zeitpunkt einen Klimanotstand für das 22. Jahrhundert zu deklarieren, ist nicht nur hysterisch, sondern angesichts der vordringlichen ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zynisch.
Eine Musterschüler-Rolle der reichen, aber CO2-armen Schweiz ist global kontraproduktiv aufgrund des absehbaren Scheiterns der deutschen oder schweizerischen Energiewende. Aus dem angeblichen Innovationsvorsprung wird schnell ein Negativ-Vorbild, wenn wir wie Deutschland ideologisch-emotional getrieben auf Illusionen oder Subventionen aufspringen.
Umweltpolitik kann und darf nicht auf Klimapolitik reduziert werden und diese nicht auf einen CO2-Nullausstoss. Eine CO2-Steuer unterliegt aber genau diesem Fehler. Eine solide Klimapolitik muss andere Umweltprobleme (z.B. Landschaftsverschandelung durch von Windräder, Ressourcenverschwendung durch Batterien oder Lagerung von Solar-Panelabfällen) sowie die Ungewissheiten der Klimaforschung mitberücksichtigen, neue Technologien via Grundlagenforschung fördern, die Kosten der Erwärmung durch Anpassung reduzieren und schliesslich «no-regrets»-CO2-Reduktionen ins Auge fassen.
Der beste Ansatz für die Schweiz wäre eine sektorielle und geografische Ausweitung des EU-Emissionshandels. Dieser wäre nicht nur effizienter, sondern auch weniger subventionistisch-dirigistisch. Denn ein Cap-and-Trade-System ist nicht nur marktnäher und einheitlicher, sondern auch leichter international ausdehnbar. Hohe CO2-Steuern im Inland führen früher oder später zu Importbelastungen der «grauen» CO2-Importe und damit zu handelspolitischen Konflikten. Ein Cap-and-Trade-System ist viel besser internationalisierbar und je nach Klimafolgen schrittweise anpassbar.
Der Autor ist emeritierter Professor für Wirtschaft und Politik an der Universität Basel, Mitglied des Akademischen Beirats des Liberalen Instituts und Vorstandsmitglied des Carnot-Cournot-Netzwerks.
Tags:
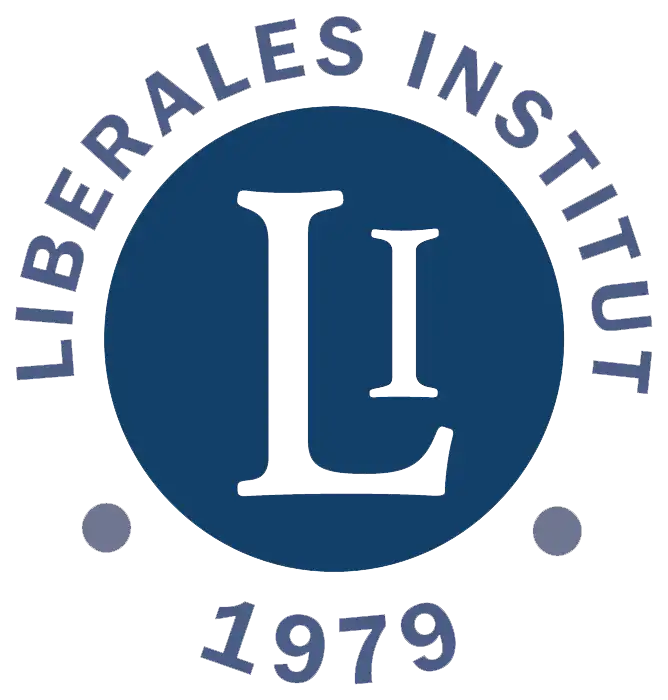
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Immer auf dem neusten Stand bleiben
Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.
LIBERALES INSTITUT
Scheideggstrasse 73
8038 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 364 16 66
institut@libinst.ch
INSTITUT LIBÉRAL
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne, Suisse
Tel.: +41 (0)21 510 32 00
liberal@libinst.ch
ISTITUTO LIBERALE
Via Nassa 60
6900 Lugano, Svizzera
Tel.: +41 (0)91 210 27 90
liberale@libinst.ch

Rund einmal pro Monat Informationen über aktuelle Publikationen und Events erhalten.